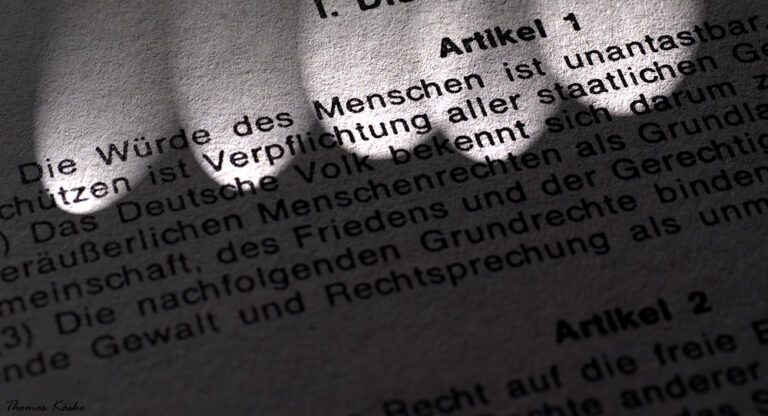
Seit November 2023 nehmen die Verbote von Vereinen und Vereinigungen zu, insbesondere in der Palästina-Solidaritäts-Bewegung. Gleichzeitig steigen die Verfahren wegen „Volksverhetzung“ oder „Billigung von Straftaten“ massiv an – meist im Kontext der Palästina-Solidarität, aber auch wenn andere Positionen zum Ukrainekrieg vertreten werden als die der Bundesregierung. Es ist klar: Mit der Kriegspolitik kommen die Verbote.
Viele Organisationen, auch wir als KO, sind im Visier des Inlandsgeheimdienstes und des Innenministeriums. Wir werden insbesondere wegen unserer Arbeit in der Palästina-Soli-Bewegung erwähnt. Der „Verfassungsschutzbericht“ ist keine neutrale Berichterstattung, sondern eine Markierung der Positionen und Organisationen, die kriminalisiert werden sollen. Sie dienen damit auch immer der Spaltung. Die ins Visier Genommenen sollen isoliert und innerhalb der Bewegung und Gesellschaft ausgeschlossen werden. Dazu dienen bestimmte Unterstellungen und Narrative wie zum Beispiel, dass die Bewegung „unterwandert“ werden würde. Vor diesem Hintergrund wollen wir in der Artikelreihe verschiedene Fragen behandeln: Warum ist der Kampf um Grundrechte notwendig? Welche Schlussfolgerungen können wir aus den vergangenen Verbote ziehen? Und wie sollten wir mit potentiellen zukünftigen Verboten umgehen?
Der erste Artikel von Klara Bina reflektiert die Bedeutung des Kampfes für Grundrechte vor dem Hintergrund romantischer Vorstellungen des Klassenkampfs und im Kontext der Widersprüche der bürgerlichen Herrschaft. Diese Widersprüche führen zu Problemen sowohl für die Arbeiterklasse und ihren Kampf, als auch für die bürgerliche Klasse und der Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft. Der Text will eine Lanze für die „kleinen“ Kämpfe um Grundrechte brechen und benennt eine Lücke in der Diskussion der KO (und darüber hinaus): Es fehlt ein Verständnis für die Entstehung von Klassenbewusstsein im Kontext der historisch konkreten Klassenherrschaft.
Verbote und der Kampf um Grundrechte – Teil 1
Ein Plädoyer dafür, den Kampf für Grundrechte im Kontext der Widersprüche der Klassenherrschaft zu verstehen
von Klara Bina
Internationale Umbrüche sorgen für gesellschaftliche Eruptionen, die der Klassenfeind ausnutzt. Dabei werden die Interessen der Arbeiterklasse tiefgreifend angegriffen. Die ökonomischen Existenzbedingungen werden z.B. mit Angriffen auf Bürgergeld und Arbeitsrechte in Deutschland infrage gestellt, es gibt Kürzungen öffentlicher Mittel für Bildung und Erziehung. Die Grundrechte auf Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit werden beschnitten. Daraus ergeben sich für die Arbeiter und kommunistische Bewegung überall – auch in Deutschland – Fragen nach Bedingungen und Methoden des Klassenkampfes.
Lanze brechen für die „kleinen“ Kämpfe
„Kämpfen“ – das geht einigen im innerkommunistischen und innerlinken Diskurs leicht über die Lippen. Im Idealfall ist es der Klassenkampf, der geführt, sogar angeführt werden soll. Vor lauter großnr Ideen revolutionär-kämpferischer Klassenkämpfe bleiben die wirklichen Kämpfe der Klasse häufig auf der Strecke – und damit auch die notwendigen Kämpfe, die geführt werden müssten zur Steigerung des Klassenbewusstseins und der Organisierung der Massen, die wiederum notwendige Bedingungen des Klassenkampfes sind. Für diese relevanten ‚kleinen‘ Kämpfe soll hier eine Lanze gebrochen werden. Dabei nehme ich hier zwar die allgemeine Frage des Klassenkampfes als Ausgangspunkt, möchte mich aber dann zügig auf die Frage des Kampfes um Grundrechte fokussieren, um ihre aktuelle Relevanz in der BRD zu demonstrieren.
Ökonomismus und Romantik
Im Rahmen der Diskussionen um den politischen Beschluss zur Massenarbeit führte die KO im Vorlauf ihrer zweiten Vollversammlung eine Diskussion über die Frage, was eigentlich Klassenkampf bedeutet und ob alle Kämpfe der Klasse schon Klassenkampf seien. Insbesondere war die Verengung auf eine ökonomistische Sichtweise Gegenstand der Diskussion (hier ein Beitrag von mir, unter dem Stichwort „Massenarbeit“ sind weitere Beiträge zu finden). Kämpfe um Grundrechte fanden damals weniger Beachtung. Bemerkenswert ist eine gegenläufige politische Bewertung, wenn es um „kleine“ ökonomische Kämpfe einerseits und gleichermaßen „kleine“ Grundrechtskämpfe andererseits geht. Bei ökonomischen Kämpfen neigt die Mehrheit in der Bewegung dazu, diese recht schnell zu überhöhen, bei Grundrechtskämpfen, die teilweise sogar größere gesellschaftliche Relevanz haben, diese herunterzuspielen und als illusionäre Kämpfe zu bezeichnen. Dahinter liegen unterschiedliche unzulängliche Betrachtungsweisen, romantische Vorstellungen vom Betriebskampf und auch ein Mangel an Kampferfahrungen, die kollektiv diskutiert und vermittelt sind und sich entsprechend kaum in lebendige Diskurse, inhaltliche Auseinandersetzungen und begründeten Überzeugungen übersetzen. Inwiefern aber diese Vorstellungen mangelhaft sind, soll hier kurz angedeutet werden, in der Hoffnung, dass sich eine lebendige Diskussion um diese Fragen entspinnen lässt.
Romantik, Ungeduld und Opportunismus
Die Überhöhung ökonomischer Kämpfe1, vor allem der Betriebskämpfe, resultiert aus unterschiedlichen Quellen. Die Rolle der Industriearbeiterklasse aufgrund ihrer ökonomischen Macht wird zwar richtig erkannt, aber schablonenhaft angewendet und die konkreten historischen, nationalen und politischen Zusammenhänge ignoriert. Hinzu kommt als zweite Quelle die Bequemlichkeit in der Anwendung, wie wir sie auch in der Imperialismusfrage sehen. Der Arbeiter im Betrieb als der Prototyp des Klassenkampfes, dessen starker Arm es anders wollen soll als die verweichlichte Mittelklasse es je könnte. Solche Bilder lassen die Herzen der Revolutionäre höherschlagen und schneller als sie denken, tappen sie in die Falle der Sozialdemokratie. Schließlich die dritte Quelle: Die romantische Verklärung des Arbeiters an der Maschine in einer hochindustriellen, vor Produktivität strotzenden imperialistischen Metropole. Wie schnell hier die revolutionäre Romantik in Ungeduld umschlagen kann, davon ist die Geschichte der Betriebskämpfe prall gefüllt. Nicht selten schlägt der Ökonomismus in der Analyse entweder in Rechtsopportunismus oder Linksradikalismus um. Dieser die objektiven Bedingungen ignorierend und auf radikalere Kämpfe orientierend, jener die objektiven Bedingungen verabsolutierend und die kämpfende Arbeiterschaft beschwichtigend.
Eine Lücke, die wir schließen müssen
Im Politischen Beschluss zur Massenarbeit spiegelt sich unsere Diskussion über den Begriff des Klassenkampfes und der Klasse wider. Ein wichtiger Aspekt, der aber meiner Ansicht nach zu kurz kommt und noch einiges an Arbeit von uns abverlangen wird, ist die Frage danach, unter welchen Bedingungen Klassenbewusstsein entsteht und sich entwickelt im Verhältnis zu den gesellschaftlich vermittelten Kampfbedingungen. Diese Schwachstelle des Beschlusses zur Massenarbeit ist eine Leerstelle, die uns auf die Füße fällt, wenn es darum geht, Klassenkämpfe in ihrem jeweils konkreten historisch-gesellschaftlichen Kontext zu begreifen. Was ist damit gemeint?
Die Klassen – tatsächlich beide, die Arbeiterklasse und die herrschende Kapitalistenklasse – sind in einen ökonomisch, politisch und kulturell spezifischen Kontext eingebettet, der ihr Bewusstsein auf mannigfaltige Weise beeinflusst. Dieser historisch entstandene und gesellschaftlich vermittelte Kontext drückt sich in unterschiedlichsten Weisen als Erklärungs- und Legitimationskitt für den Ausbeutungsmechanismen der kapitalistischen Gesellschaft aus und hält diese an den jeweiligen Verhältnissen gefesselt. Diese (Erklärungs-)Muster können variieren vom Standortdenken bis zum Rassismus oder religiöse und kulturalistische Muster, um nur ein paar sehr offensichtliche zu nennen. Sie können aber auch Sicherheits- und Angstdiskurse beinhalten, die zum Beispiel den Kampf um höhere Löhne als in diesem Moment unwichtiger erscheinen lässt als einen Kampf um eine erhöhte „Sicherheitsinfrastruktur“ oder „Migrationsabwehr“. Zusammenfassend: ohne all die wichtigen Punkte bezüglich des Klassenkampfes im Beschluss zu relativieren, sei hiermit gesagt, dass wir diese Lücke schließen müssten, um genau nicht in die oben beschriebenen Fallen einer Überhöhung des betrieblichen, wie auch Unterschätzung oder Relativierung anderer Kämpfe zu tappen.
Beschränkung der Arbeiterklasse durch Integration
Ein weiterer Aspekt des Kampfes, dem hier besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden soll, wird durch die Verfasstheit der gesellschaftlichen Herrschaft bedingt. Das Augenmerk liegt hier auf der Implikation eines bürgerlich-demokratisch verfassten Rechtsstaates einerseits für die Arbeiterklasse, der Rechte zukommen sollen und andererseits für die Kapitalistenklasse, deren Interessen realisiert werden sollen. Eine solche bürgerlich-demokratische Ordnung produziert auf beiden Seiten für beide Klassen multiple Widersprüche, die sie – die bürgerliche Ordnung bzw. der bürgerliche Staat – in irgendeiner Weise, meist in einer sehr spannungsreichen Weise, unter Kontrolle halten muss.
Für die Arbeiterklasse besteht der Widerspruch hauptsächlich darin, dass sie sich mit jedem weiteren zugestandenen Recht in ihrer eigenen Entwicklung, sowohl hinsichtlich ihres Klassenbewusstseins als auch hinsichtlich der Spielregeln des Kampfes in den unterschiedlichsten Arenen, beschränken muss. Ein hervorragendes Beispiel aus der BRD für diesen Widerspruch bietet das Betriebsverfassungsgesetz. Tatsächlich wirkt sich aber auch in besonderem Maße die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in dieser Weise aus. Ist es erst einmal erlaubt, alles zu sagen, wirkt sich die Normalisierung des radikalen Inhalts, z.B. von radikaler Kapitalismuskritik mehr als Integrationsinstrument auf das Bewusstsein der Massen aus, als dass es den gewünschten Effekt der Steigerung des Klassenbewusstseins hätte. Das ist eine Form, wie sich erkämpfte oder zugestandene Rechte beschränkend auf die Arbeiterklasse auswirken, notwendig auswirken können. Ein demokratisches Klima kann zur Vertiefung der Integration der Arbeiterklasse in die bürgerliche Ordnung führen. Diese Integration ist in hohem Maße im Interesse der bürgerlichen Herrschaft, denn sie dient dazu, Widersprüche zumindest zeitweilig einzuebnen. Das ist die andere Form, in der Rechte als Spielregeln die Denk- und Handlungsfähigkeit der Arbeiterklasse als Klasse beschränken können. Eine affirmative Haltung gegenüber dem Kompromiss, der sich als Ergebnis von Kämpfen z.B. um Versammlungsfreiheit ergibt, entwickelt sich schleichend – bis der Kompromisscharakter kaum noch erkennbar ist. Die im Grundgesetz festgeschriebene Versammlungsfreiheit hat schon einen Kompromisscharakter insofern, dass es dem Staat vorbehalten ist, diese durch Gesetze, z.B. durch Anmeldepflicht, einzuschränken.
Widersprüche als potenzielle Risse
Andererseits der Staat: je stärker er sich als demokratischer und freiheitlicher Staat geriert, umso mehr kristallisiert sich im Bewusstsein seiner Glieder und der unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft der wirkliche Glaube an den Inhalt der Demokratie und der Grundrechte. So gerät der bürgerliche Staat im Verlauf seiner Gesamtgeschichte ständig in Widerspruch zum eigenen Narrativ von Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Je länger die Phase einer relativ stabilen bürgerlichen Demokratie dauert, umso blumiger werden die Illusionen und umso fester der Glaube an diese Versprechen.
Das gilt jedoch nicht nur für die Seite der Arbeiterklasse, sondern in hohem Maße für die Seite der bürgerlichen Klasse samt ihrer stets dienlichen Schichten – die zu ihr hinaufschauenden Kleinbürger und die Arbeiteraristokratie. Diese sind die Operatoren der Herrschaftsabsicherung, wenn es um die Realisierung der Interessen der Kapitalistenklasse geht, ob sie nun Ämter bekleiden, wie Richter oder Funktionen ausführen in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Institutionen, von Schulen und Universitäten bis zu Gewerkschaften. Auf Dauer geht es aber in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht ohne die Einschränkung eben dieser Grundrechte (dazu sehr empfehlenswert ist der Artikel von Arnold Schölzel in der jungen Welt vom 29.06.24 „Im ‚Kaltstart‘ zum Notstand“). Sogar die imperialistischen Staaten können trotz der Extraprofite, aus denen sie die eigene Arbeiterklasse bestechen, nicht nachhaltig auf Einebnung der Widersprüche orientieren. Die aus Sicht der herrschenden Klasse eigentlich bessere Herrschaftsform der bürgerlichen Demokratie, muss aufgrund externer und interner Widersprüche relativiert oder gar unterminiert werden.
Die Feststellung der Widersprüche, die sich mit einer demokratischen Ordnung für die Kapitalistenklasse ergeben, sollte aber nicht nur zur Skandalisierung und Entlarvung des eigentlich unterdrückerischen und repressiven Charakters der bürgerlichen Herrschaft beitragen. Diese Erkenntnis ist äußerst hilfreich für die verschiedenen Kämpfe der Arbeiterklasse. Sie befähigt uns dazu, die Widersprüche als potentielle Risse in den Reihen der Herrschenden und ihrer Funktionäre zu betrachten und im Sinne der Desintegration der Arbeiterklasse zu nutzen. Um das aber zu tun, müssen diese Widersprüche zur vollen Entfaltung kommen oder in den Kämpfen dazu gebracht werden.
Entlarvung durch gemeinsames Durchfechten
Wenn wir – in den unterschiedlichsten Bereichen – um unsere Grundrechte kämpfen, machen wir nichts anderes als die bürgerliche Klasse entlang ihrer eigenen Versprechen herauszufordern und nutzen dafür im besten Fall alle uns zur Verfügung stehenden Mittel, sowohl juristische als auch propagandistische. Die wirkliche Fratze des kapitalistischen Staates lässt sich nicht einfach durch Erläuterungen entlarven, sie muss on the ground mit den Betroffenen gemeinsam durchfochten herausgefordert und der daraus resultierende Kampf durchgefochten werden. Dabei ist jeder mögliche Ausgang kurz- oder mittelfristig im Sinne der Arbeiterklasse. Im Falle einer erfolgreichen juristischen Auseinandersetzung werden Grundrechte tatsächlich erkämpft, und zwar gegen den Staat bzw. gegen die Exekutive. Im Falle eines negativen Ausgangs wird der repressive Charakter durch Erfahrung bestätigt und kann somit als bewusste Grundlage für die weitere politische Arbeit dienen, sagen wir auf einer höheren Bewusstseinsstufe. Im ersten Fall müssen wir der potenziellen Verstärkung von Illusionen entgegenwirken, wenn z.B. höchstrichterliche Urteile in unserem Sinne gefällt werden sollten. Dann heißt es, nicht dort stehen zu bleiben und die nächsten Herausforderungen anzugehen. Im zweiten Fall sollten wir entsprechend der Möglichkeiten, die uns repressive Maßnahmen lassen, einen kreativen Umgang mit diesen suchen und das Bewusstsein über den Charakter des Staates entlang der gemeinsam gemachten Erfahrung steigern.
Legalismus und Linksradikalismus
Dieser spannungsreiche und widersprüchliche Prozess verlangt von beiden Klassen anstrengende Vermittlungsarbeit ab. Die herrschende Klasse nutzt alle ihr zur Verfügung stehenden ideologischen und sonstigen Mittel zur Beschwichtigung der Massen und vor allem ihrer eigenen Reihen zwecks Legitimierung von Demokratieabbau und Staatsumbau. Dazu müssen Diskussionen und Auseinandersetzungen bis zu einem gewissen Grad zugelassen und Positionen, Fragen und Zweifel austariert werden, bis sich die Meinung der Herrschenden als herrschende Meinung durchsetzen kann.
Auf der Seite der Arbeiterklasse aber sind es unzählige Fallen, in die hineingetappt werden kann, wenn es um die Frage der Verteidigung der Grundrechte geht. Entlang der üblichen Grundausrichtungen, die gewöhnlich als Schattierungen von Legalismus einerseits und Linksradikalismus andererseits auftreten, können der tiefe Glaube an die demokratischen Institutionen, wie die Rechtsprechung, sowie eine Totalablehnung des Kampfes um Grundrechte als illusionär beobachtet werden. Genauso wenig aber wie sich der Klassenfeind aufgrund der Schwierigkeiten der Vermittlungsarbeit davon abhalten lässt, in seinem Sinne und mit größten Anstrengungen diese Arbeit zu leisten, sollten wir das auch tun, in vollem Bewusstsein dessen, dass wir uns noch viel mehr anstrengen müssen.
Abhängen der Massen
Linksradikalismus kann auch verstärkt werden, indem die jeweilige Phase des Kampfes nicht richtig erkannt wird. Vor allem unter dem Eindruck konkreter Kämpfe, die zeitweise eine gewisse Dynamik in der Protestbewegung erzeugen und / oder unter dem Eindruck harter Repression kann eine revolutionäre Situation vermutet werden, obwohl die konkrete Auseinandersetzung noch lange keine gesamtgesellschaftliche Relevanz erlangt hat.
Aus solchen falschen Einschätzungen heraus wird häufig der Kampf um die Grundrechte relativiert und als illusionär und / oder nicht mehr nötig angesehen, da es jetzt nur noch auf die direkte Aktion der Massen ankäme. Solche Fehleinschätzungen können einen defätistischen Fatalismus erzeugen, weil sie letztlich den Kampf nicht in Bahnen lenken, die entsprechend der Bedingungen realistische Ziele anpeilt, sondern ins Leere laufen und meistens demobilisierend auf die Massen wirken, indem diese abgehängt werden.
Anstrengende Vermittlungsarbeit ist angesagt
Soweit sehr allgemein zu den Dynamiken, die die Widersprüche im bürgerlich-demokratisch verfassten kapitalistischen Rechtsstaat erzeugen, wenn die Versprechen der Grundrechte und Demokratie an ihre realen Grenzen kommen, so wie wir es seit der Militäroperation Russlands zuerst und in einem viel verstärkten Maße seit dem 7.Oktober 2023 gegenüber der Palästina-Solidaritätsbewegung beobachten können.
Eine kluge Ausnutzung der Widersprüche auf der Seite der herrschenden Klasse unter Berücksichtigung der Bewusstseinslage der Massen und der objektiven gesellschaftlichen Bedingungen des Kampfes, ist derzeit das meiner Ansicht nach richtige Herangehen im Kampf um unsere Grundrechte.
Wir müssen auch – in der gesamten Bewegung – realisieren, dass offene Diskussionen und gemeinsame und solidarische Anstrengungen im Kontext der Kämpfe gegen Repressionen, von uns als Akteure in der Bewegung organisiert werden müssen. Unter anderem ist genau das mit der anstrengenden Vermittlungsarbeit hinsichtlich der hier aufgeworfenen, bestimmt auch kontroversen, Thesen gemeint. Wir selbst müssen die Orte für die Reflexion dieser Kämpfe und die unterschiedlichen Taktiken und Herangehensweisen schaffen. Dabei spielt die Integration oder mindestens Nutzbarmachung von Akteuren außerhalb der Bewegung, wie z.B. Akademiker, praktizierende Juristen etc., eine wichtige Rolle.
Wir müssen noch etwas realisieren: der Stand des Bewusstseins in der Arbeiterklasse, aber auch in der Bewegung, hinsichtlich des Charakters des imperialistischen Staates und den Erfahrungen im Kampf gegen ihn, sind auf einem sehr niedrigen Niveau und die Auseinandersetzungen um diese Fragen zeichnen sich nicht gerade durch Lebendigkeit aus. Das muss sich ändern und die KO hat die Verantwortung, ihren Beitrag dazu zu leisten.
1 Siehe hierzu meinen Diskussionsbeitrag: https://kommunistische-organisation.de/artikel/den-klassenkampf-nicht-zerlegen-darum-geht-es/