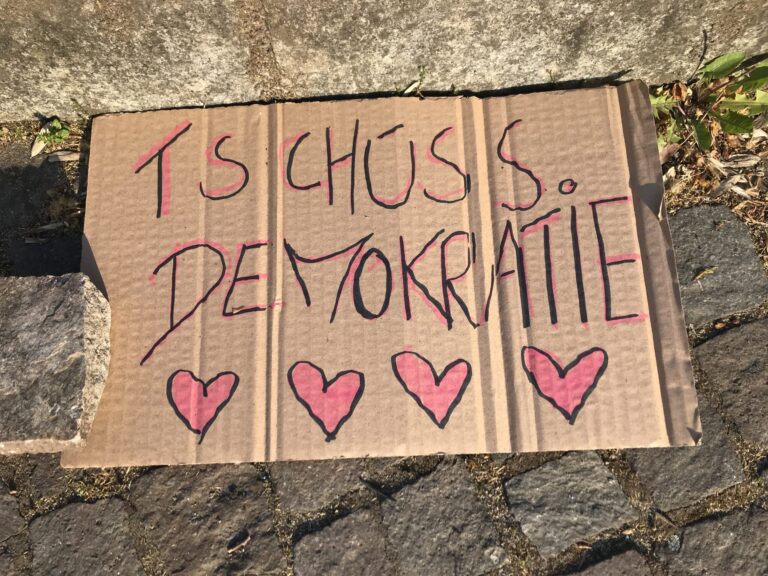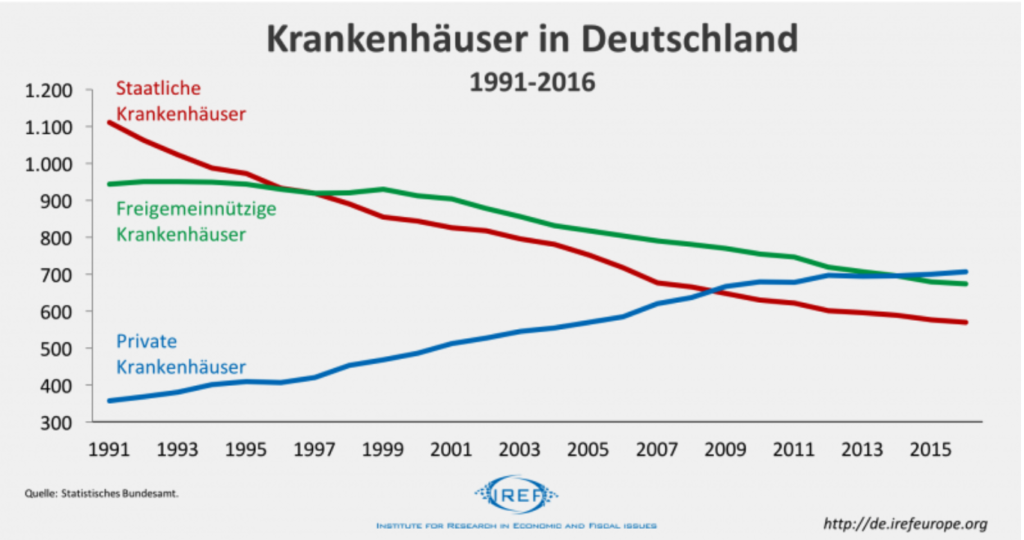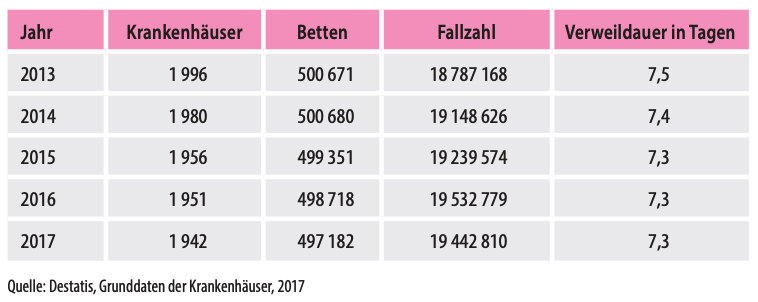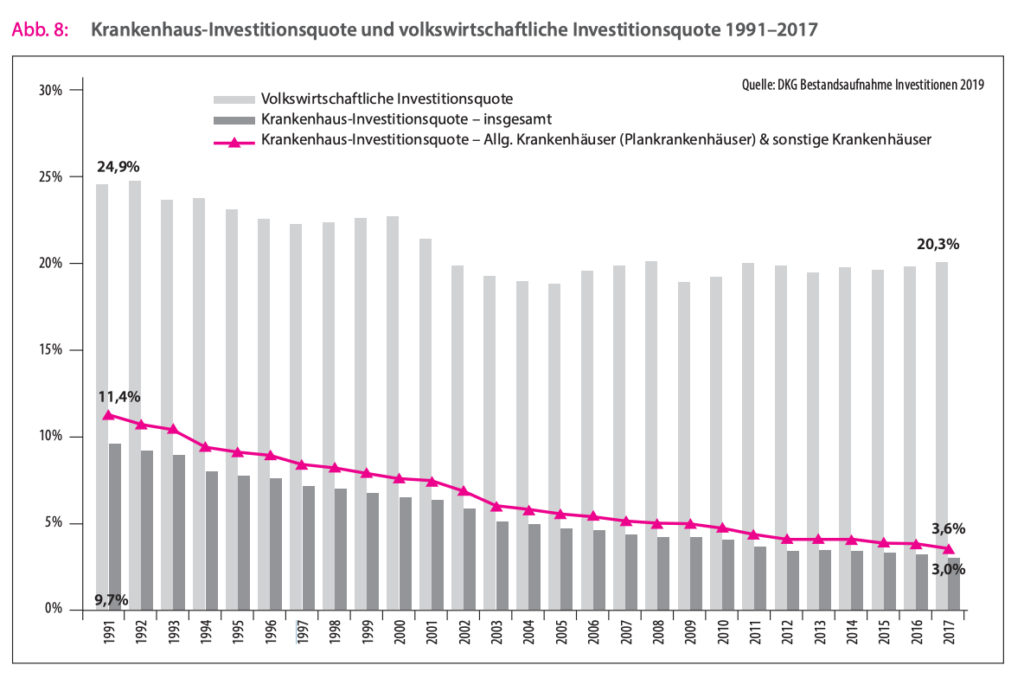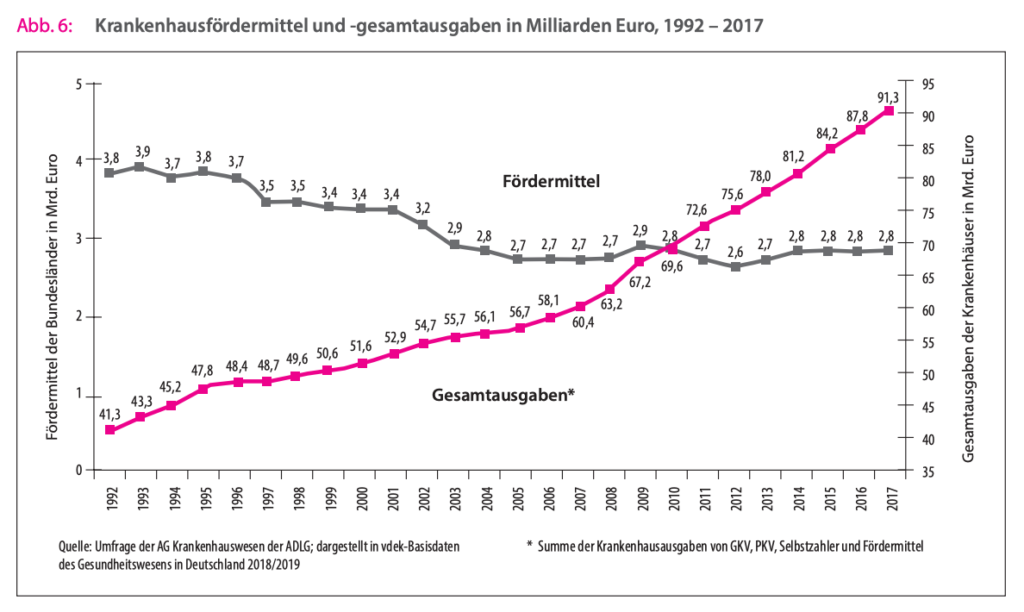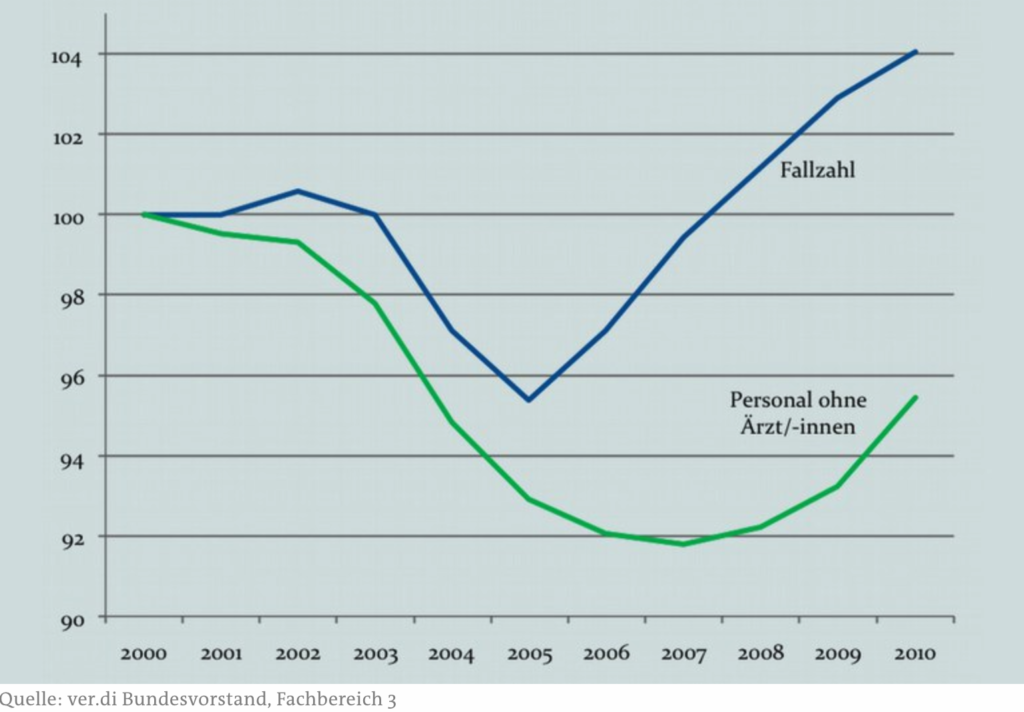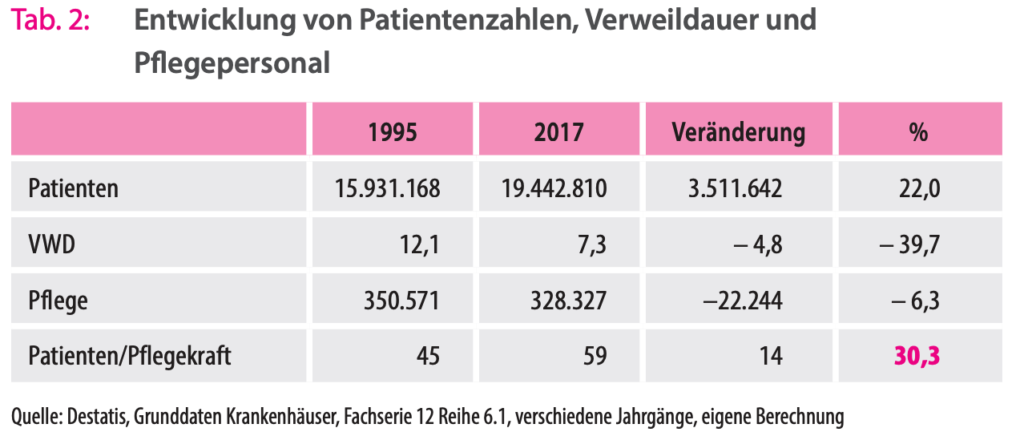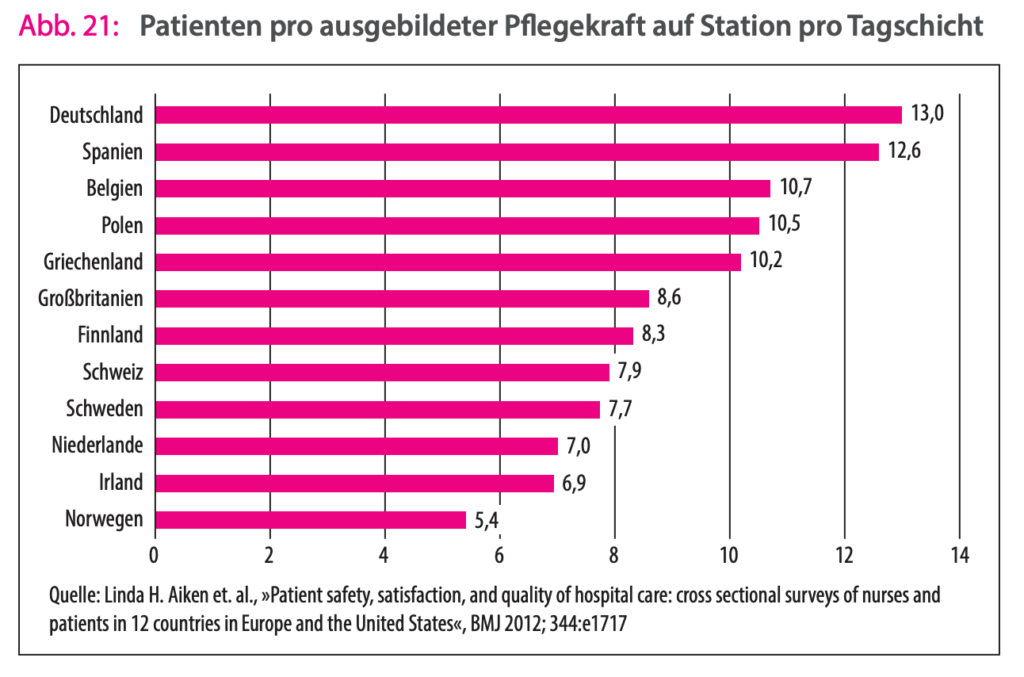Kritik einer opportunistischen Strömung in der Arbeiterbewegung
von Thanasis Spanidis
1. Einleitung
Leo Trotzki gilt bis heute Vielen als der tragische Held der Russischen Revolution; als der ehrliche Revolutionär, der scharfsinnig die angebliche „Deformation“ der Sowjetunion durch den „Stalinismus“ analysierte und kritisierte und der erst durch einen Auftragsmord Stalins zum Schweigen gebracht werden konnte. Diese Sichtweise bekommen wir nicht nur von bekennenden Anhängern Trotzkis zu hören, sondern sie wird auch aktiv von bürgerlichen Antikommunisten verbreitet. So wird Trotzki auch in der liberalen Zeitschrift „Der Spiegel“, in einem Artikel, der vor Falschbehauptungen nur so strotzt, als „Prophet“ geehrt und betrauert (Sarovic 2017). Selbst die russische Netflix-Serie „Trotzki“, die von vielen Trotzkisten als Angriff auf das Andenken ihres Vordenkers kritisiert wurde, stellt Trotzki eigentlich eher als tragische Figur dar, die zwar viele Fehler hatte, aber letzten Endes zum Opfer des eigentlichen Bösewichts wurde: Stalin. Vielleicht am bezeichnendsten drückt es eine 1994 freigegebene Einschätzung der CIA aus: „Sowohl Stalin als auch Trotzki waren Feinde der Freiheit, aber es ist dennoch wahr, dass der bessere Mann verloren hat.“ (CIA 1994). Allein die Tatsache, dass geschworene Antikommunisten und Konterrevolutionäre sich ausgerechnet für einen Mann einsetzen, der sich selbst als Anführer der wahren Anhänger der Weltrevolution, der „Bolschewiki-Leninisten“ verstand und Stalin vorwarf, er habe mit dem Kapitalismus in Wirklichkeit seinen Frieden gemacht, sollte jeden kritischen Geist zum Nachdenken anregen – hält diese verbreitete Darstellung den Tatsachen wirklich stand?
In diesem Artikel geht es nicht um eine Biografie Trotzkis oder um eine genaue Nacherzählung der Ereignisgeschichte. Trotzdem hängt Trotzkis Lebensgeschichte eng mit den Standpunkten zusammen, die er vertrat, weshalb es sinnvoll ist, die wichtigsten Stationen in seinem Leben und den Gang seiner Auseinandersetzungen mit Lenin und Stalin zunächst darzustellen. Damit beschäftigt sich der erste Teil des Artikels, der unterteilt ist in die Zeit vor der Oktoberrevolution, dann den Streit um das sogenannte „Testament Lenins“, die innerparteilichen Auseinandersetzungen nach der Revolution und Trotzkis Rolle nach seiner Ausweisung aus der Sowjetunion.
Dann werden wir uns der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Trotzkis Standpunkten zuwenden. Dabei wird sich die Analyse auf drei Bereiche konzentrieren:
Erstens Trotzkis organisationspolitische Auffassungen, also seine Frage, wie die revolutionäre Partei zu organisieren sei.
Zweitens die Kritik Trotzkis an der „Bürokratie“ und seine Einschätzung der sowjetischen Gesellschaft.
Drittens die Auseinandersetzung zwischen seinem Konzept der „permanenten Revolution“ und der Parole des „Sozialismus in einem Land“, oder anders formuliert: Trotzkis Kritik an der Position, die Stalin, die Sowjetführung und die Kommunistische Internationale (Komintern) zur Frage der Weltrevolution einnahmen, an der Außenpolitik der Sowjetunion und der Politik der verschiedenen kommunistischen Parteien.
Wer sich weniger für die genauen historischen Abläufe im Leben Trotzkis interessiert, kann natürlich auch das Kapitel 2 überspringen und direkt zur Auseinandersetzung mit Trotzkis inhaltlichen Positionen im Kapitel 3 übergehen.
Die Auswahl der drei Bereiche im Kapitel 3 ist keineswegs zufällig, sondern sie betrifft die Kernpunkte des Trotzkismus, wie er bis heute über seine verschiedenen Strömungen hinweg vertreten wird. Zudem handelt es sich bei allen drei Fragen um Auffassungen, die auch von anderen linken Kritikern der Sowjetunion und der kommunistischen Bewegung vertreten werden. Die Auseinandersetzung damit hat also weit mehr als nur eine historische Bedeutung. Es geht im weiteren Sinne nicht nur um Trotzki, sondern um den Trotzkismus als eine bis heute einflussreiche Strömung der Arbeiterbewegung und um Diskussionen, denen Kommunisten immer wieder begegnen.
Anstelle einer Schlussfolgerung folgt am Ende eine kurze, bei weitem unvollständige Darstellung des Trotzkismus und der Rolle, die dieser nach Trotzkis Tod in der Sowjetunion gespielt hat. An dieser Stelle sollen auch einige grundlegende Schlüsse über den Charakter des Trotzkismus als Theorie und politischer Strömung (oder eher: Vielzahl von Strömungen) gezogen werden.
Das Ergebnis der Analyse sei der Transparenz halber hier bereits vorweggenommen: Trotzkis Analyse der Sowjetunion und der „Bürokratie“ überzeugt nicht und sie stellt eine Abkehr von der marxistischen Analysemethode dar. Seine Behauptung, Stalin habe die Weltrevolution aufgegeben und nur noch die Macht einer bürokratischen Kaste bewahren wollen, wird durch die historischen Tatsachen widerlegt. Trotzkis organisationspolitische Positionen stehen im Widerspruch zur leninistischen Konzeption der Partei neuen Typs und sind nicht geeignet, der revolutionären Organisierung der Arbeiterklasse eine Orientierung zu geben. Der Trotzkismus ist damit als eine opportunistische Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung einzuschätzen, die in diesen Fragen einen schädlichen Einfluss ausübt. In der Praxis zeigte sich dieser negative Einfluss bereits bei Trotzki selbst, der aus dem Exil nahezu seine gesamte Energie darauf verwendete, seinen persönlichen Krieg gegen Stalin, die Sowjetunion und die Komintern zu führen und im Zuge dessen nicht einmal davor zurückschreckte, Kommunisten an die US-amerikanischen Behörden auszuliefern. Im Verlauf der folgenden Jahrzehnte haben sich trotzkistische Gruppen immer wieder auf die Seite konterrevolutionärer und reaktionärer Bewegungen gestellt.
Natürlich bedeutet die scharfe Kritik, die hier an Trotzki als historischer Person, am Trotzkismus als Theorie und politischer Kraft sowie an einzelnen trotzkistischen Organisationen geübt wird keineswegs, dass man deshalb einzelnen Trotzkisten mit Feindseligkeit begegnen sollte. Immerhin handelt es sich ja in vielen Fällen um Leute, die es ehrlich meinen mit dem Kampf für eine sozialistische Gesellschaft. Es ist also wichtig zu verstehen, aus welchen Gründen der Trotzkismus auch heute noch eine gewisse Attraktivität auf Menschen ausstrahlt, die von den Schrecken des Kapitalismus dazu bewegt werden, sich zu organisieren und für eine andere Gesellschaft zu kämpfen. Der Trotzkismus ist hier scheinbar ein attraktiver Bezugspunkt, da er eine Kritik am Kapitalismus und eine sozialistische Zielstellung mit einer grundsätzlichen Ablehnung des „Stalinismus“ verbindet. Dass ein solcher Ansatz auf den ersten Blick plausibel erscheint, sollte niemanden verwundern. Es liegt zum einen daran, dass die Bourgeoisie und die bürgerliche Geschichtsschreibung es geschafft haben, eine völlige Dämonisierung der Sowjetunion in der Zeit von Stalin als absolut vorherrschende Sichtweise zu etablieren. Der Trotzkismus bietet hier die bequeme Möglichkeit, sich selbst als Kommunist verstehen zu können, sich dabei aber von den „Verbrechen des Stalinismus“ abzugrenzen und damit weitaus weniger Angriffsfläche für antikommunistische Polemik zu bieten. Zudem bietet die trotzkistische Theorie der „Bürokratie“ und des „Verrats an der Weltrevolution“ eine (wenn auch falsche) Erklärung für die Geschichte der kommunistischen Bewegung im 20. Jahrhundert und den Untergang der sozialistischen Staaten. Damit entfällt auch die mühsame Arbeit, diese Geschichte, ihre Fehler und die Ursachen dieser Fehler im Detail zu analysieren. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch nicht vergessen, dass es nicht zuletzt auch Fehler der kommunistischen Bewegung selbst waren, die den Trotzkismus als attraktive Alternative erscheinen lassen. Diese Fehler hier genau zu analysieren, wird nicht möglich sein. An ein paar Stellen sollen sie aber zumindest angesprochen werden.
2. Der Verlauf des Konflikts
2.1 Trotzkis Leben vor der Oktoberrevolution
Trotzki, oder Lew Dawidowitsch Bronstein, wie er eigentlich hieß, wurde 1879 als Sohn relativ wohlhabender Bauern jüdischen Glaubens in der Ukraine, die damals Teil des russischen Zarenreichs war, geboren. Vom orthodoxen Judentum kehrte er sich später ab und wandte sich zunächst der bäuerlichen Volkstümlerbewegung, später dann der sozialistischen Arbeiterbewegung zu. Nach seiner Verhaftung durch die zaristische Polizei 1898 beschäftigte Bronstein sich in der Verbannung in Sibirien mit dem Marxismus und nahm ironischerweise den Namen Trotzki an – den Namen eines Aufsehers im Gefängnis. Der junge Trotzki trat der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) bei, die sich aber schon 1903 spaltete: In die reformistischen Menschewiki einerseits, die glaubten, Russland sei für die sozialistische Revolution noch nicht reif und die zudem eine Partei anstrebten, in der jeder Mitglied sein könne, der sich selbst dazu zählt – und in die revolutionären Bolschewiki unter Führung Lenins andrerseits, die nur aktive, in Parteizellen organisierte Parteimitglieder akzeptierten.
Trotzki stellte sich in dieser Auseinandersetzung auf die Seite der Menschewiki. In seiner Schrift „Unsere politischen Aufgaben“ polemisierte er scharf gegen Lenin, den er den „Führer des reaktionären Flügels unserer Partei“ nannte (Trotzki 1904). In den folgenden Jahren bis zur Oktoberrevolution war Trotzkis Haltung vor allem von Schwankungen und ständigen Positionswechseln gekennzeichnet. 1912 formierte Trotzki den sogenannten „Augustblock“: Dieser vereinte den ultralinken Flügel der Bolschewiki, die Otzowisten, die die Arbeit im Parlament grundsätzlich ablehnten, mit dem rechten Flügel der Menschewiki, den Liquidatoren, die ausschließlich den legalen Kampf für Reformen innerhalb des Systems führen wollten (Walker 1985, S. 14). Diese extrem entgegengesetzten Flügel zu vereinen, war nur möglich, weil beide Strömungen am Rand des Zusammenbruchs standen und in Lenin einen gemeinsamen Gegner hatten. Lenins Schriften aus diesen Jahren erwähnen Trotzki Hunderte Male und zwar ausschließlich sehr negativ. Einige wenige ausgewählte Beispiele zeigen, dass Lenin und Trotzki keineswegs Kampfgefährten waren, sondern erbitterte Gegner, die sich gegenseitig zutiefst verachteten. So schreibt Lenin über Trotzki:
„Trotzki dagegen repräsentiert lediglich seine persönlichen Schwankungen und sonst nichts. 1903 war er Menschewik,- 1904 rückte er vom Menschewismus ab, und 1905 kehrte er, lediglich mit ultrarevolutionären Phrasen prunkend, zu den Menschewiki zurück; 1906 wandte er sich abermals vom Menschewismus ab; Ende 1906 verfocht er Wahlabkommen mit den Kadetten (d. h. ging faktisch wieder mit den Menschewiki), und im Frühjahr 1907 sprach er auf dem Londoner Parteitag davon, daß der Unterschied zwischen ihm und Rosa Luxemburg ‚eher ein Unterschied in der individuellen Schattierung als in der politischen Richtung‘ sei. Trotzki begeht heute ein Plagiat an dem geistigen Rüstzeug der einen, morgen an dem der anderen Fraktion, und darum gibt er sich als über beiden Fraktionen stehend aus.“ (Lenin 1910a, S. 398; die Kadetten waren eine liberale antisozialistische Partei im russischen Zarenreich, Anmerkung des Autors). „Trotzki dagegen hat niemals irgendeine „Physiognomie“ gehabt, und er hat auch keine; bei ihm gab es nur hinüber- und herüberwechseln von den Liberalen zu den Marxisten und umgekehrt, Bruchstücke von Wörtchen und wohlklingenden Phrasen, die von hier und dort zusammengeholt wurden.“ (Lenin 1914, S. 153). „Mit Trotzki kann man nicht prinzipiell diskutieren, denn er hat keinerlei feste Anschauungen.“ (Lenin 1911, S. 351). „Und diese Unwahrheit bringt erstens die völlige theoretische Verständnislosigkeit Trotzkis zum Ausdruck“ (Lenin 1910a, S. 396). „Trotzki vereinigt alle, denen der ideologische Zerfall am Herzen liegt; alle, denen die Verteidigung des Marxismus gleichgültig ist.“ (Lenin 1910b, S. 5).
Trotzki äußerte sich über Lenin nicht weniger verachtungsvoll. So schreibt er 1913 in einem Brief an den Nikolaj Tschcheidse, einen georgischen Menschwiken und Vorsitzenden der menschewistischen Parlamentsfraktion: „In einem Wort, der ganze Leninismus ist auf Lügen und Falschheiten begründet und beinhaltet die Saat seines eigenen Untergangs“ und fordert die „Zerstörung der Grundlagen des Leninismus, der unvereinbar mit der Orientierung der Arbeiter in einer politischen Partei ist und perfekt auf dem Nährboden der Spaltung gedeiht“ (zitiert nach: Walker 1985, S. 12). Dass Trotzki und seine Anhänger später so taten, als hätten Lenin und Trotzki nur geringfügige Differenzen miteinander gehabt, ist absurd.
Nach Beginn des Ersten Weltkriegs erkennt Trotzki dann den Krieg als imperialistisch an, übernimmt jedoch nicht Lenins Position, den Krieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln. Er argumentiert, dass der Krieg das revolutionäre Potenzial der Massen gelähmt habe und man erst nach Kriegsende an eine Revolution denken könne. Nach der bürgerlich-demokratischen Februarrevolution Anfang 1917 kehrte Trotzki aus dem Exil nach Russland zurück und stellte sich zunächst gegen die von Lenin geführte Zimmerwalder Linke, die die revolutionäre Opposition gegen den Krieg vereint hatte. Lenin schrieb wütend an Alexandra Kollontai: „So ein Schwein ist dieser Trotzki – Linke Phrasen und ein Block mit den Rechten gegen die Zimmerwalder Linken!!“ (Lenin 1917, S. 262). Zu dieser Zeit war Trotzki Teil einer Gruppe namens „Interregionale Konferenz der Vereinigten Sozialdemokraten“. Diese Gruppe näherte sich in den folgenden Monaten den Bolschewiki an und strebte die Vereinigung mit ihnen an. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die gemeinsame Partei den Namen Bolschewiki aufgeben müsse. Die Bolschewiki lehnten das ab, da Trotzkis Organisation anders als die Bolschewiki eine marginale Splitterorganisation war und es somit nicht ernsthaft um eine Vereinigung auf Augenhöhe gehen konnte, sondern eher um einen kollektiven Beitritt von Trotzkis Anhängern zu den Bolschewiki. Trotzki brach die Verhandlungen mit der Aussage ab, er könne sich nicht als Bolschewik bezeichnen – derselbe Trotzki, der sich einige Jahre später als den rechtmäßigen Bewahrer der historischen Tradition der Bolschewiki anpries (Walker 1985, S. 18). Trotzdem schloss seine Gruppe sich im August den Bolschewiki an.
Trotzki befürwortete im Oktober 1917 wie Lenin und Stalin die revolutionäre Machtübernahme. Seine Rolle in der Revolution wird von Zeitgenossen wie dem US-amerikanischen Journalisten John Reed als die eines begnadeten Redners und herausragenden Agitators beschrieben (Reed 1957). In der Revolutionsregierung wird er zum Volkskommissar für Äußere Angelegenheiten. Die vordringlichste Aufgabe der Regierung war der Abschluss eines Waffenstillstands. Trotzki hatte dazu die Anweisung bekommen, in den Verhandlungen in Brest-Litowsk mit dem Deutschen Reich die diktierten Friedensbedingungen zu akzeptieren. Eigenmächtig beschloss er stattdessen, die Armee zu demobilisieren und gab die Parole „Weder Krieg noch Frieden“ heraus. Daraufhin konnte die deutsche Armee tief in russisches Gebiet vorstoßen, da die demobilisierte russische Armee dem nun nichts mehr entgegensetzen konnte. Lenin hob den Befehl Trotzkis sofort auf und musste daraufhin ein viel schlimmeres Friedensdiktat unterschreiben.
1918 begann in Russland der Bürgerkrieg. Nachdem die konterrevolutionäre Weiße Armee den Bürgerkrieg gegen die Revolution begonnen hatte, wurde Trotzki zum Volkskommissar für Militär und Flottenangelegenheiten. In dieser Funktion spielte er eine sehr wichtige Rolle als Organisator des Aufbaus der Roten Armee, die im Bürgerkrieg erfolgreich die Revolution verteidigte.
Nach Lenins Tod kam es zum verschärften Konflikt zwischen Trotzki und Stalin, wobei Trotzki sich als legitimen „Nachfolger“ Lenins betrachtete. Dafür berief er sich auf verschiedene Dokumente, die er als „Testament“ Lenins bezeichnete und die bis heute von bürgerlichen und trotzkistischen Historikern meistens unter diesem Namen gehandelt werden.
2.2 Lenins angebliches „Testament“
Bis heute gehört das sogenannte „Testament“ Lenins zu den bekanntesten historischen Dokumenten aus der Zeit. Weithin bekannt ist auch, dass Lenin sich darin für die Ersetzung Stalins als Generalsekretär aussprach. Oft hört man auch die völlig falsche Behauptung, er habe in dem „Testament“ Trotzki als seinen „Nachfolger“ auserkoren. Lenin, so eine häufige Darstellung, habe am Ende seines Lebens die Gefahren des „Stalinismus“ erkannt und davor gewarnt.
Warum sollte man sich überhaupt mit diesem Text und den Auseinandersetzungen darum beschäftigen? Ist es nicht relativ unwichtig, was der sterbende Lenin über Stalins Führung dachte? Sollten wir Stalins Politik nicht anhand der Fakten der darauf folgenden drei Jahrzehnte bewerten? Sicherlich. Dennoch ist es interessant, sich die Geschichte dieses sogenannten „Testaments“ kurz vor Augen zu führen. Erstens dient sie als Anschauungsbeispiel dafür, mit welchen Methoden Trotzki die innerparteilichen Auseinandersetzungen führte und sich in der Partei selbst zunehmend ins Abseits manövrierte. Zweitens ist sie auch ein Beispiel dafür, wie bis heute im vorherrschenden bürgerlichen, ebenso wie im trotzkistischen Geschichtsbild die historische Wahrheit aus politischen Motiven verzerrt wird.
Es fängt bereits bei der fragwürdigen Namensgebung für die Briefe an, die Lenin 1922, ein paar Monate vor seinem letzten Schlaganfall, an den Parteitag der Bolschewiki geschrieben hatte. Denn als „Testament“ hatte Lenin sie nie bezeichnet und es spricht auch nichts dafür, dass er sie so verstanden wissen wollte. Trotzdem sind diese Briefe bis heute als „Lenins Testament“ bekannt, nachdem Trotzki sie so nannte. Laut Trotzki wurden diese Briefe dann auch von der Gruppe um Stalin „unterdrückt“, also verschwiegen, um jede Infragestellung der Macht der Parteiführung zu verhindern.
Der US-amerikanische Journalist Max Eastman schrieb 1925 einen Text mit dem Titel „Since Lenin Died“, in der er die Existenz des angeblichen „Testaments“ für die westliche Öffentlichkeit enthüllte und seine vermeintlichen Inhalte darstellte. Laut dem trotzkistischen Historiker Isaac Deutscher und anderen Historikern war seine Darstellung akkurat und stellte die damalige Parteiführung (Sinowjew, Kamenew, Stalin) bloß. Tatsächlich jedoch stellte Eastman den Inhalt der Briefe massiv verfälscht dar. Er tat dies mit explizitem politischem Ziel, wie er am Ende seines Textes selbst schreibt, nämlich die Autorität der sowjetischen Führung anzugreifen. Laut Eastman wollte Lenin Trotzki die neue Führung übertragen. Zu dieser völlig unwahren Behauptung konnte er nur kommen, indem er die Passagen, in denen es um Trotzki ging, ausließ. Nun lag die Schuld für diese Lüge aber nicht allein bei Eastman. Vielmehr gab er später zu, dass er die Briefe gar nicht selbst gelesen hatte, sondern die vermeintlich entscheidenden Sätze daraus am Rande des 13. Parteitags der Bolschewiki 1924 von Trotzki selbst erfahren hatte. Es war also Trotzki selbst, der im Interesse seiner persönlichen Machtpolitik dafür sorgte, dass eine stark verfälschte Version der Briefe an die Öffentlichkeit gelangte (Lih u.a.. 1995, S. 20).
Doch damit endete Trotzkis unehrlicher Umgang mit dem „Testament“ nicht. Nachdem Eastmans Buch veröffentlicht wurde, schickte Stalin es dem Politbüro, das empört über die darin enthaltenen Verfälschungen war. Stalin schien Trotzki jedoch zu glauben, dass er mit Eastmans Buch bzw. für die Übermittlung von Informationen über Lenins Briefe an Eastman nichts zu tun hatte. Er beschränkte sich auch darauf, die offensichtlichsten Fälschungen anzusprechen und warf Trotzki lediglich vor, durch sein Schweigen Eastmans falsche Version zu decken. Dadurch sah Trotzki sich gezwungen, in der sowjetischen Zeitung Bolschewik am 1.9.1925 einen Artikel zu schreiben, in dem er Eastmans Behauptungen vehement widerspricht. Lenin habe gar keinen „letzten Willen“ hinterlassen, weil das auch dem Charakter der Partei widerspreche, seine Briefe seien auch nicht verschwiegen, sondern auf dem Parteitag ausführlich diskutiert worden. All diese Unterstellungen seien böswillige Erfindungen. So schrieb damals Trotzki – behalten wir im Hinterkopf, dass Trotzki selbst der Ursprung dieser böswilligen Erfindungen war, was damals aber noch nicht bekannt war (Lih u.a., 1995, S. 21f).
Einige Jahre später, als der Bruch zwischen Trotzki und dem Politbüro der Partei endgültig vollzogen war, änderte Trotzki wiederum seine Meinung. 1932 wiederholte er in einem Text mit dem irreführenden Titel „Über Lenins Testament“ genau Eastmans Behauptung, dass das „Testament“ verschwiegen wurde (Walker 1985, S. 26ff). Auch Isaac Deutscher folgte dieser Version. Tatsächlich wurden die Dokumente jedoch allen Parteitagsdelegierten vorgelesen. Stalin bot daraufhin dem Parteitag seinen Rücktritt vom Amt des Generalsekretärs an. Der Parteitag lehnte ab (Lih u.a.. 1995, S. 18f). Die Parteitagsreden wurden allen Mitgliedern zugänglich gemacht und es ging in verschiedenen Reden auf Parteitagen und -konferenzen wiederholt um diesen Text. So sprach auch Stalin vor dem Zentralkomitee ziemlich unbefangen über die Kritik, die in dem Text an ihm geäußert wurde (Stalin 1927a, S. 153ff). Sowohl über Lenins Briefe als auch über die Diskussionen darüber war auch in der sowjetischen Presse berichtet worden (Acton/Stableford 2006, S. 203). Er ist des Weiteren in den Lenin-Werken enthalten (Band 36), die bereits zu Lebzeiten Stalins herausgegeben wurden. Die Behauptung, dass die Parteiführung und Stalin diesen Text verheimlicht oder „unterdrückt“ hätten, war also schlicht und einfach eine dreiste Lüge. Jedes Mitglied des Zentralkomitees der Bolschewiki, ja im Grunde jeder Bürger der Sowjetunion der regelmäßig die Zeitungen las musste das wissen. Man kann sich vorstellen, dass Trotzki durch das Verbreiten dermaßen durchsichtiger und leicht widerlegbarer Lügen nicht unbedingt dafür sorgte, dass man ihm mit mehr Vertrauen begegnete.
Die Eastman-Affäre ist auch deshalb relevant, weil sie zur fortschreitenden Diskreditierung Trotzkis bei der gesamten Parteiführung beitrug. Es erscheint wahrscheinlich, dass auch im Politbüro einige Zweifel daran blieben, ob Trotzki wirklich nichts mit der Entstehung dieser Lügen zu tun hatte – wie wir heute wissen, zurecht. So schreibt Lih, dass es im Politbüro einen Streit darüber gegeben habe, wie weiter mit dem Ereignis umzugehen wäre, wobei Stalins vorsichtiger Umgang mit Trotzki vor allem Sinowjew aufstieß, der für härtere Konsequenzen eintrat (Lih u.a.. 1995, S. 23)
Was sagte das „Testament“ tatsächlich aus? Tatsächlich handelte es sich um mehrere Texte, die der kranke Lenin an verschiedenen Tagen diktierte. Neben anderen Fragen wie der Erhöhung der Zahl der ZK-Mitglieder ging er in zwei Briefen vom 25.12.1922 und 4.1.1923 auf Stalin, Trotzki, Sinowjew, Kamenew, Bucharin und Pjatakow ein. Über Stalin und Trotzki hieß es im ersten der beiden Briefe: „Gen. Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermeßliche Macht in seinen Händen konzentriert, und ich bin nicht überzeugt, daß er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen. Anderseits zeichnet sich Gen. Trotzki, wie schon sein Kampf gegen das ZK in der Frage des Volkskommissariats für Verkehrswesen bewiesen hat, nicht nur durch hervorragende Fähigkeiten aus. Persönlich ist er wohl der fähigste Mann im gegenwärtigen ZK, aber auch ein Mensch, der ein Übermaß von Selbstbewußtsein und eine übermäßige Vorliebe für rein administrative Maßnahmen hat.“ (Lenin 1922, S. 579)
Etwas später schreibt Lenin über Trotzkis „Nichtbolschewismus“, den man ihm aber nicht als persönliche Schuld anrechnen könne. Am Ende schreibt er einschränkend: „Natürlich mache ich die eine wie die andere Bemerkung nur für die Gegenwart und für den Fall, daß diese beiden hervorragenden und ergebenen Funktionäre keine Gelegenheit finden sollten, ihr Wissen zu erweitern und ihre Einseitigkeit zu überwinden.“
In dem Brief vom 4.1. ist Lenins Kritik gegenüber Stalin schärfer: „Stalin ist zu grob, und dieser Mangel, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten durchaus erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Deshalb schlage ich den Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte, und jemand anderen an diese Stelle zu setzen, der sich in jeder Hinsicht von Gen. Stalin nur durch einen Vorzug unterscheidet, nämlich dadurch, daß er toleranter, loyaler, höflicher und den Genossen gegenüber aufmerksamer, weniger launenhaft usw. ist.“ (ebd, S. 580).
Weit davon entfernt, ein Plädoyer für die Ersetzung Stalins durch Trotzki zu halten, kritisiert Lenin beide Führer. Es fällt auf, dass Stalin im Wesentlichen wegen persönlicher Mängel kritisiert wird, Trotzki hingegen auch wegen politischer Fehler (Nichtbolschewismus, Bürokratismus), was für einen Führungskader einer kommunistischen Partei sicherlich die schwerwiegendere Kritik ist. Wer daraus ein Plädoyer für Trotzki als neuen Parteiführer macht, verfälscht bewusst die Tatsachen.
Zwischen dem ersten und dem zweiten Brief Lenins lagen elf Tage. Wie kam Lenin von seiner vorsichtigen Kritik an Stalin im ersten Brief zu seiner deutlich schärferen im zweiten? Vermutlich, weil Lenin zwischenzeitlich von einem persönlichen Streit zwischen Stalin und seiner Frau Nadeschda Krupskaja erfahren hatte. Wir wissen darüber von Lenins Schwester Maria Uljanowa: Stalin war damals für den persönlichen Kontakt des Politbüros der Partei zum kranken Lenin verantwortlich. Als er erfuhr, dass Lenins Frau Krupskaja regelmäßig die strikte Anweisung der Ärzte missachtete, ihrem Mann aus gesundheitlichen Gründen keine politischen Nachrichten zuzuspielen, wies er sie harsch zurecht. Stalin und Krupskaja versöhnten sich später wieder, aber ihr Streit war sicherlich eine Ursache von Lenins plötzlicher Wut auf Stalin.
2.3 Die innerparteilichen Auseinandersetzungen nach der Revolution
Nach Lenins Tod verschärften die Auseinandersetzungen sich wieder. Trotzki verstieß in dieser Zeit immer wieder gegen das Fraktionsverbot der Bolschewiki. Bereits 1921 hatte er sich von Lenin dafür kritisieren lassen müssen, dass er bei den Auseinandersetzungen zur Gewerkschaftsfrage eine „Plattform“, also eine Fraktion gebildet hatte. Hier konnte Trotzki sich allerdings noch auf eine Ausnahmeregelung zur Ermöglichung einer offenen Diskussion berufen, die das Zentralkomitee einige Monate zuvor beschlossen hatte (Lenin 1921a, S. 30 und Lenin 1921c, S. 62). Formal war er also im Recht, wie Lenin zugestand, doch „vom Standpunkt der revolutionären Zweckmäßigkeit war das schon eine gewaltige Übersteigerung des Fehlers, die Bildung einer Traktion auf Grund einer falschen Plattform.“ (Lenin 1921a, S. 30). Doch es zeigte sich in den folgenden Jahren, dass Trotzki auch ohne solche Ausnahmegenehmigungen keinerlei Hemmungen hatte, sich des Mittels der Fraktionsbildung zu bedienen.
1923 wählte er erneut diesen Weg, um seinen Standpunkt in der Partei durchzusetzen. Nachdem er dafür kritisiert wurde, versprach er, dieses Vorgehen einzustellen. Doch 1926 formulierte er eine Kritik am Programm der Komintern, die er allerdings nicht dem Kongress zeigte, sondern nur einer ausgewählten Gruppe von Delegierten. Erneut wurde er kritisiert und musste versprechen, nicht mehr zum Mittel der Fraktionsbildung zu greifen.
Im Oktober 1927, zwei Monate vor dem Parteitag, organisierte die Partei eine breite und offene Diskussion in der gesamten Mitgliedschaft über die Positionen des Zentralkomitees sowie die der Opposition. Anschließend wurde über die Thesen der beiden Gruppen abgestimmt. Die Abstimmung endete in einer vernichtenden Niederlage für Trotzki: Nur 4000 Parteimitglieder unterstützten seine Thesen, während 724.000 für die des ZK stimmten, bei einigen Tausenden Enthaltungen (Walker 1985, S. 23).
Daraufhin entschied sich Trotzki im November erneut dazu, die Parteidisziplin zu brechen, indem er mit seinen Anhängern zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution (am 7. November) eine öffentliche Antiregierungsdemonstration durchführte (Walker 1985, S. 23). Trotzki selbst beschreibt die Situation in seiner Autobiografie folgendermaßen: „Als die Zeit für den fünfzehnten Parteitag näher rückte, der für Ende 1927 angesetzt war, merkte die Partei immer mehr, dass sie an einer historischen Wegscheide angekommen war. (…) Trotz eines monströsen Terrors erwachte in der Partei der Wunsch, die Opposition anzuhören. Dies konnte nur durch illegale Mittel erreicht werden. Geheime Treffen wurden in verschiedenen Teilen von Moskau und Leningrad abgehalten, die von Arbeitern und Studenten beider Geschlechter besucht wurden, die sich in Gruppen von zwanzig bis Hundert oder Zweihundert versammelten, um einen Vertreter der Opposition anzuhören. (…). Insgesamt besuchten etwa 20.000 Menschen solche Treffen in Moskau und Leningrad. Die Zahl wuchs weiter an.“ (Trotsky 1930, Kapitel XLII).
Es ist klar, dass diese Demonstrationen und Treffen kein Selbstzweck waren. Da, wie Trotzki selbst schreibt, es um illegale Versammlungen ging, die einen Regierungswechsel vorbereiten sollten, ist es offensichtlich, dass es darum ging, die Regierung notfalls auch gewaltsam zu stürzen. Auch Stalin argumentierte jetzt, dass Trotzkis Kritik an der „entarteten Bürokratie“ zwangsläufig darauf hinauslief, dass die Trotzkisten sich gegen den revolutionären Staat wenden würden: „Wenn die Staatsmacht entartet ist oder entartet, lohnt es sich da, sie zu schonen, zu schützen, zu verteidigen? Natürlich nicht. Wenn eine günstige Gelegenheit eintritt, diese Macht „abzusetzen“, sagen wir, wenn der Feind auf 80 Kilometer an Moskau herankommt – ist es dann nicht klar, dass die Situation ausgenutzt werden müsste, um diese Regierung wegzufegen und eine neue, eine Clemenceau-Regierung, das heißt eine trotzkistische Regierung, einzusetzen?“ (Stalin 1927b, SW 10, S. 297)
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Stalin von repressiven Maßnahmen wie Disziplinarverfahren noch zurückgeschreckt und immer die Notwendigkeit betont, den Kampf gegen den Trotzkismus auf ideologischer Ebene zu führen. 1924, als es bereits scharfe Konflikte mit Trotzki gab, hatte Stalin beispielsweise gegen die Genossen argumentiert, die über eine Spaltung oder gar Repressalien gegen die Trotzkisten sprachen: „Das ist Unsinn, Genossen. Unsere Partei ist stark und mächtig. Sie wird keine Spaltungen zulassen. Was die Repressalien anbelangt, so bin ich entschieden dagegen. Nicht Repressalien, sondern einen entfalteten ideologischen Kampf gegen den wiederauflebenden Trotzkismus brauchen wir jetzt.“ (Stalin 1924b, S. 319). Er hielt sogar eine Zusammenarbeit unter bestimmten Bedingungen immer noch für möglich: „Eine dauerhafte Zusammenarbeit der Leninisten mit Trotzki ist nur möglich, wenn dieser seinen alten Ballast vollends abwirft, wenn er sich dem Leninismus vollends anschließt“ (ebenda, S. 314).
Nun aber riss ihm der Geduldsfaden. Auf der Plenumssitzung des Zentralkomitees und der Zentralen Kontrollkommission der Partei im Oktober 1927 sprach Stalin zur Rolle der Opposition. Er betont, dass Lenin wesentlich härter mit der früheren Opposition umgegangen war: 1921 wollte er Schljapnikow aus der Partei ausschließen lassen, weil dieser in einer Parteizelle die Beschlüsse des Obersten Volkswirtschaftsrates kritisiert hatte. Die jetzige Opposition publiziere stattdessen vertrauliche Beschlüsse der Partei in ausländischen Zeitungen und organisiere illegale parteifeindliche Druckereien mit bürgerlichen Intellektuellen, ohne dass die Partei dagegen einschreite. Noch auf der vergangenen Plenartagung im August 1927 hatte Stalin gegen den sofortigen Ausschluss Trotzkis und Sinowjews aus dem Zentralkomitee gesprochen, wie ihn einige gefordert hatten. Nachdem er für seine Nachsicht kritisiert wurde und die Opposition das von ihr im August gegebene Versprechen, ihre Fraktion aufzulösen, erneut gebrochen hatte, änderte Stalin nun seine Position und sprach sich ebenfalls für den Ausschluss aus dem ZK aus. Als Zwischenrufe den Ausschluss der beiden auch aus der Partei fordern, verweist Stalin jedoch darauf, dass solche Entscheidungen der Parteitag treffen solle (Stalin 1927a, S. 167).
Stalin war also kein übertriebener Scharfmacher, der für einen kompromisslosen Kampf gegen alle Andersdenkenden stand, sondern er vertrat eine moderate Herangehensweise und war länger als andere führende Bolschewiki bereit, der oppositionellen Fraktion mit Toleranz zu begegnen. Obwohl der Beschluss über das Fraktionsverbot von 1921 den Parteiausschluss explizit als Konsequenz für Fraktionsbildung vorsah, sahen die Bolschewiki jahrelang davon ab, diese Maßnahme anzuwenden. Erst als der wiederholte Bruch der Parteidisziplin so weit ging, dass Trotzkis Anhänger Gewalt gegen die Regierung vorbereiteten, wurden von der Partei entsprechende Konsequenzen gezogen.
Es entspricht nicht den Tatsachen, wenn immer wieder, von trotzkistischer oder bürgerlicher Seite, Trotzkis Ausschluss aus der Partei als brutale Säuberung, als rücksichtslose Neutralisierung eines unbequemen Kritikers dargestellt wird. Trotzki wurde nicht wegen seiner Meinung ausgeschlossen, sondern weil er immer und immer wieder das Statut der Partei verletzte und damit seinem völligen Mangel an Respekt vor den Regeln der innerparteilichen Demokratie Ausdruck verlieh.
Bei Trotzkis Ausschluss aus der Partei betonte Stalin, dass den Oppositionellen um Trotzki „nur“ vorgeworfen wurde, sich mit Konterrevolutionären verschworen zu haben und die Parteidisziplin zu missachten. Er unterstrich explizit, dass niemand den Vorwurf erhoben hatte, Trotzki sei Drahtzieher einer militärischen Verschwörung. Daher wurden die oppositionellen Führer auch nicht verhaftet, sondern nur ausgeschlossen.
Der Kampf um die Führung im Politbüro wird von Trotzkisten zudem in der Regel als Rivalität zwischen Trotzki und Stalin dargestellt. Auch das ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Trotz ihrer tiefgehenden politischen Differenzen war Stalin nicht durchgehend der Erzfeind Trotzkis. So hatte z.B. Sinowjew oft eine deutlich härtere Gangart gegen Trotzki gefordert als es Stalin tat (Lih 1995, S. 23). Auch waren Trotzki und Stalin keineswegs die ganze Zeit über das Zentrum der Auseinandersetzungen, sondern es gab wechselnde Konstellationen: Sinowjew war eine Zeit lang als Generalsekretär der Komintern deutlich einflussreicher als Trotzki und wurde von Stalin, Molotow und Bucharin als problematischste Figur in der Parteiführung gesehen. In dieser Phase argumentierte Stalin dagegen, dass man Trotzki genauso stark bekämpfen sollte wie Sinowjew, weil er Trotzki und seinen Anhängern die Chance geben wollte, wieder ein konstruktives Verhältnis zur Partei zu entwickeln (Lih 1995, S. 25). Trotzki entschied sich jedoch gegen ein solches konstruktives Verhältnis.
Die meisten führenden Kommunisten der Welt sahen Trotzkis Rolle zunehmend als problematisch an und stimmten Stalins Kritik zu. Das gilt z.B. auch für den berühmten italienischen Kommunisten Antonio Gramsci. Gramsci saß seit 1928 im faschistischen Italien im Gefängnis und war somit in die Politik der Komintern nicht mehr direkt involviert. Gerade deshalb wird er oft als „unverfälschte“ und angeblich „antistalinistische“ Stimme hochgehalten (so z.B. der Trotzkist Peter Thomas, vgl. Workers‘ Liberty 2010). In Wirklichkeit teilte Gramsci die Position Stalins im Kern und kritisierte Trotzki immer wieder. Er wirft ihm ultralinken Voluntarismus vor, denn er sei ein „Theoretiker des Frontalangriffs zu einer Zeit (gewesen), in der dieser nur zur Niederlage führt.“ (Gramsci: Gefängnishefte, H 6, S. 816). Auf Trotzkis Aussage, dass sich seine Theorie nach fünfzehn Jahren bestätigt habe, merkt Gramsci an: „In Wirklichkeit war seine Theorie als solche weder fünfzehn Jahre zuvor noch fünfzehn Jahre danach gut“ (Gramsci: Gefängnishefte, H 7, S. 873f).
Dass Trotzki für sich und seine Anhänger nun die Selbstbezeichnung „Bolschewiki-Leninisten“ wählte, die von Trotzkisten teilweise bis heute benutzt wird, kann als besondere historische Absurdität betrachtet werden. Auf die beiden Bestandteile dieses Begriffspaares konnte Trotzki wohl kaum einen legitimen Anspruch anmelden. Bolschewik war er den Großteil seines politischen Lebens nicht gewesen, denn Mitglied der Bolschewiki war er nur 1917-1927. Vorher und nachher bestand sein politischer Aktivismus wesentlich gerade in der Bekämpfung dieser Partei. Und auch die letzten Jahre seiner Mitgliedschaft verbrachte er damit, immer wieder die Parteidisziplin zu brechen und gegen das gewählte ZK zu arbeiten. Und Leninist? Vor seiner (vorübergehenden) Kehrtwende im Jahr 1917 war Trotzki zumeist ein erbitterter Gegner Lenins gewesen und auch danach vertrat er in entscheidenden Fragen entgegengesetzte Positionen zu Lenin. Die historische Wahrheit ist, dass es Stalin und nicht Trotzki war, der Lenins Politik in den wesentlichen Fragen fortsetzte.
2.4 Trotzki im Exil
1929 wurde Trotzki aus der Sowjetunion ausgewiesen. Auch diese Entscheidung war ein verhältnismäßig mildes Vorgehen: Die Führung der Bolschewiki konnte Trotzki als Kopf einer Opposition, die weiterhin innerhalb und außerhalb der Partei den Zielen der Partei entgegenwirkte, nicht im Land lassen. Sie wollte den ehemaligen Kampfgenossen aber auch nicht verhaften. Daher wurde er ins Ausland geschickt, wobei er von der Sowjetunion noch 1500 US-Dollar ausgezahlt bekam, zur damaligen Zeit eine nicht geringe Summe Geld, die auch als ein letztes Zeichen des guten Willens zu verstehen war (Losurdo 2012, S. 91).
Auch Trotzki hatte zu dieser Zeit noch keinen endgültigen Bruch mit den Bolschewiki vollzogen. Er kritisierte die Regierung noch nicht als „konterrevolutionär“, sondern als inkompetent und schwankend. Dieser Bruch erfolgte dann im Jahr 1933. Im April lehnte Trotzki einen Bruch mit der Komintern noch ab. Mitte Juli änderte er seine Position dann und sprach davon, dass man die Komintern nicht reformieren könne, sondern eine neue Internationale aufbauen müsse. Auch die KPdSU sei keine Partei mehr, sondern nur noch „ein Herrschaftsapparat in den Händen einer unkontrollierten Bürokratie“. Trotzdem sei die Sowjetunion immer noch ein Arbeiterstaat, der ohne eine erneute Revolution zurückerobert werden könne. Aber auch diese Einschränkung ließ Trotzki dann im Oktober fallen: „Keine normalen ‚verfassungsmäßigen‘ Wege sind übrig, um die herrschende Clique zu beseitigen. Die Bürokratie kann nur durch Gewalt gezwungen werden, die Macht in die Hände des Proletariats zu übergeben.“ (zitiert nach Getty 1986, S. 26).
Trotzkis Haltung zum Terrorismus
Was Trotzki in der Öffentlichkeit sagte, war jedoch nur die eine Seite seiner Aktivitäten. Die andere bestand darin, dass er auch aus dem Ausland weiterhin im geheimen Kontakt mit anderen Oppositionsführern in der Sowjetunion stand und mit ihnen den Umsturz plante. Über seinen Sohn Lew Sedow unterhielt Trotzki Kontakte mit sowjetischen Funktionären oder Touristen, die aus der Sowjetunion ins Ausland reisten oder umgekehrt. Er schickte geheime Briefe an Oppositionelle wie Radek, Sokolnikow, Preobraschenski und andere. Der Inhalt dieser Briefe ist nicht bekannt, da nur die Quittungen von der Post erhalten sind. Der Grund dafür ist, dass die Trotzki-Archive in Harvard von einer unbekannten Person gesäubert wurden: Während fast alle Briefe Trotzkis erhalten sind, wurde der Briefkontakt mit der innersowjetischen Opposition entfernt (ebenda, S. 34).
Der US-amerikanische Historiker Arch Getty vermutet, dass sie Anweisungen zu verschwörerischen Aktivitäten gegen die Sowjetführung enthielten (ebenda, S. 27). Karl Radek sagte später bei den Moskauer Prozessen aus, von Trotzki in einem Brief Anweisungen zu terroristischen Aktionen bekommen zu haben. Diese Aussage wird wie die anderen Aussagen der Moskauer Prozesse bis heute von der antikommunistischen Geschichtsschreibung als erpresstes falsches Geständnis gewertet. Wir wissen nun aber, dass Radek tatsächlich geheime Briefe von Trotzki empfing und dass diese, höchstwahrscheinlich wegen ihres brisanten Inhalts, aus dem Archiv entfernt wurden. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass die Aussage Radeks vermutlich der Wahrheit entsprach.
Über den sowjetischen Parteifunktionär Goltsman erhielt Sedow in Berlin den Vorschlag des führenden Trotzkisten Iwan Smirnow und anderer Oppositioneller für die Bildung eines gemeinsamen Blocks, der aus Trotzkisten, den Anhängern Sinowjews und weiteren Oppositionsgruppen bestehen sollte. Trotzki stimmte zu (ebenda, S. 28).
Getty vermutet, dass der oppositionelle Block zwar eine illegale Verschwörung darstellte, aber keinen Putsch oder terroristische Aktionen plante und dass der Block nur bis 1932 existierte (ebenda, S. 29). Es ist jedoch nicht klar, auf welcher Grundlage Getty diese Schlussfolgerung zieht. Denn erstens ist der Inhalt der Briefe nicht bekannt. Zweitens sprach Trotzki ab 1933 öffentlich darüber, dass der Sturz der „Bürokratie“ nur mit Gewalt zu bewerkstelligen sein würde. Ende 1934 wurde der Leningrader Parteisekretär und Mitglied des Politbüros Sergej Kirow, also einer der höchsten Funktionäre und zudem ein enger persönlicher Freund Stalins, von dem Attentäter Nikolajew ermordet. Trotzki macht in einem später erschienenen Aufsatz aus seiner Freude über den erfolgreichen Terroranschlag keinen Hehl: „Der ermordete Kirow, ein roher Satrap, erweckt keinerlei Sympathie. Unsere Beziehung zum Mörder bleibt nur deshalb neutral, weil wir die Motive, die ihn leiteten, nicht kennen. Wenn bekannt werden würde, daß Nikolajew bewußt für die von Kirow begangene Schändung der Arbeiterrechte Vergeltung übte, wären unsere Sympathien völlig auf Seiten des Mörders.“ (Trotzki 1938a). Zwar versichert Trotzki, dass er die alte marxistische Position, den individuellen Terror als Taktik abzulehnen, weiterhin teile. Doch natürlich hätte Trotzki das in der Öffentlichkeit auch dann behauptet, wenn er in Wirklichkeit terroristische Taktiken befürwortete. Am 26. Januar 1937 erklärte er gegenüber dem New York Evening Journal zudem ganz offen: „In der Partei hat sich Stalin über alle Kritik und den Staat gestellt. Es ist unmöglich, ihn zu beseitigen außer durch Ermordung. Jeder Oppositionelle wird ipso facto (d.h. „durch diese Tatsache selbst“, Anmerkung des Autors) zum Terroristen.“ (zitiert nach Sayers/Kahn 1946, S. 195).
Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass er nicht auch dementsprechend handelte. Und drittens gibt es auch andere Indizien und Belege dafür, dass Trotzki in der Tat einen gewaltsamen Umsturz mit terroristischen Methoden vorbereitete. Nikolaj Bucharin, zu diesem Zeitpunkt ebenfalls einer der führenden Oppositionellen in der Sowjetunion, hatte schon 1929 seinem Freund und Mitstreiter Jules Humbert-Droz eröffnet, dass man seiner Ansicht nach Stalin ermorden müsse. Dies sei auch das Ziel der von ihm geführten Opposition und ihres Bündnisses mit den Anhängern Sinowjews und Kamenews. Wir wissen, dass Trotzki mit diesen Gruppen in den folgenden Jahren im konspirativen Kontakt stand. Humbert-Droz enthüllte diese Information erst viel später in seinen Memoiren, lange nachdem er sich von der kommunistischen Weltbewegung abgewandt hatte (Losurdo 2012, S. 95; Furr 2015, S. 178). Den eindeutigsten Beleg liefert aber ein interner Geheimdienstbericht. Mark Zborowski, der eng mit Trotzki zusammenarbeitete, war ein Agent des sowjetischen Geheimdienstes. In einem Bericht vom 8. Februar 1937 schrieb er, dass Sedow mehrfach darüber gesprochen hätte, dass es nun notwendig sei, Stalin zu töten. Weil das Regime in der Sowjetunion von Stalin abhänge, würde es ausreichen, ihn zu töten, damit das ganze System zusammenbreche. Sedow versuchte zudem, Zborowski dafür zu gewinnen, einen Terroranschlag gegen Stalin zu begehen (Furr 2015, S. 290ff). Auch in Briefen zwischen Trotzki und Sedow findet sich die Formulierung, man müsse „Stalin beseitigen“, was – sicherlich bewusst – unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten offenließ (ebd, S. 130).
Hier ist nicht der Platz, um eine umfassende Untersuchung der Moskauer Prozesse vorzunehmen. An dieser Stelle soll es daher ausreichen, dass nach allem was wir wissen einige der schwerwiegendsten Vorwürfe, die bei den Prozessen gegen Trotzki (in Abwesenheit) erhoben wurden, offenbar der Wahrheit entsprachen – wobei es an dieser Stelle nicht um die Frage gehen soll, wie die juristische Beweisführung einzuschätzen ist.
Das Dewey-Komitee
Trotzki verfügte auch in den 1930ern schon über eine Vielzahl an prominenten Unterstützern. Manche waren Trotzkisten, andere einfach bürgerliche Liberale, die in Trotzki einen zu Unrecht Verfolgten sahen. In den USA bildete sich um den bekannten Philosophen John Dewey, aber auch andere Prominente (u.a. auch der ehemalige KPD-Abgeordnete Otto Rühle und das ehemalige EKKI-Mitglied Alfred Rosmer), ein Komitee, das sich für Trotzki einsetzte. Dieses Komitee übte Druck auf die mexikanische Regierung von Lazaro Cárdenas aus, Trotzki Asyl zu gewähren, womit sie schließlich erfolgreich waren. In Mexiko wurde er von dem Künstler-Ehepaar Diego Rivera und Frida Kahlo aufgenommen, wobei vor allem Rivera auch starke ideologische Sympathien für den Trotzkismus hegte.
1936-1938 fanden in der Sowjetunion die Moskauer Prozesse statt, bei denen einige Dutzende hochrangige Parteimitglieder schwerer Verbrechen wie Hochverrat und Verschwörung zum Terrorismus angeklagt und verurteilt wurden. Trotzki wurde dabei als Drahtzieher dieser Verschwörung in Abwesenheit beschuldigt. Das Dewey-Komitee besuchte Trotzki nun in Mexiko, um ihn über die Vorwürfe der Moskauer Prozesse zu befragen. Angeblich sollte es darum gehen, objektiv und vorurteilsfrei die Wahrheit herauszufinden. In Wirklichkeit war das Dewey-Komitee von vornherein extrem voreingenommen und verfolgte ein eindeutiges Ziel, nämlich Trotzki freizusprechen. Es stellte kaum kritische Fragen, bohrte nicht nach und nahm alle Aussagen Trotzkis als Beweise seiner Unschuld an (Bolton 2011).
Heute wissen wir, dass Trotzki das Dewey-Komitee angelogen hat. Beispielsweise behauptete Trotzki, seit seiner Ausreise aus der Sowjetunion nicht mehr im Kontakt mit den anderen Oppositionsführern gewesen zu sein, was jedoch ohne jeden Zweifel der Fall war. Dem Komitee reichte Trotzkis Beteuerung der eigenen Unschuld als Beweis aus und es kam zu dem bereits von vornherein feststehenden Ergebnis, alle Vorwürfe seien erfunden gewesen. Bis heute berufen sich Trotzkisten auf dieses „Urteil“, so als hätte das „Verhör“ vor dem Dewey-Komitee irgendwelche echten Erkenntnisse geliefert. In Wirklichkeit handelte es sich um eine schlechte Karikatur eines Gerichtsverfahrens. Das sahen auch Mitglieder des Dewey-Komitees so, zum Beispiel Frida Kirkway und Carleton Beals, die dem Komitee in der Überzeugung beigetreten waren, dass auch Trotzki eine faire Verteidigung verdient habe. Sie verließen das Komitee dann aber, weil es ihrer Meinung nach den ausschließlichen Zweck verfolgte, Trotzki von allen Vorwürfen freizusprechen, ohne diese ernsthaft zu prüfen (Chase 1995; Bolton 2011).
Trotzkis angebliche „Verteidigung“ der Sowjetunion im Krieg
In Europa rückte inzwischen der Krieg immer näher. Die Sowjetunion konzentrierte während der 1930er ihre Anstrengungen auf die Kriegsvorbereitung. Und Trotzki? Stellte er sich zumindest im Angesicht dieser existenziellen Bedrohung auf die Seite der UdSSR? In Worten tat er das tatsächlich, indem er immer wieder betonte, dass er und seine Anhänger die Sowjetunion entschlossen verteidigen würden.
Was Trotzki aber unter dieser „Verteidigung der Sowjetunion“ verstand, machte er z.B. in seinem Text „Die UdSSR im Krieg“ deutlich. Diese Aufgabe sei „ausschließlich durch die Aufklärung der Massen, die Agitation, und indem wir erklären, was zu verteidigen, und was zu stürzen“ zu verwirklichen (Trotzki 1939d). „Wir helfen daher der UdSSR wie China während dem Krieg mit allen Mitteln, die einer unterdrückten und nicht herrschenden Klasse zur Verfügung stehen, die in unversöhnlicher Opposition zu ihrer Regierung ist: indem wir ihren Sturz und die Machtübernahme vorbereiten. So stellt sich die Frage“ (Trotzki 1938b). Mit anderen Worten: Die Sowjetunion verteidigen, hieß für Trotzki in erster Linie, die Arbeiter im Angesicht einer drohenden feindlichen Invasion zum Sturz der sowjetischen Regierung aufzuwiegeln. Und weiter: „Wir sind für die Unabhängigkeit der Sowjet-Ukraine und, wenn die Weißrussen selbst es wollen, für die des sowjetischen Weißrusslands“ (Trotzki 1939d). Die Sowjetunion gegen eine ausländische Invasion zu verteidigen bedeutete für Trotzki also auch, den ukrainischen und weißrussischen Separatismus zu fördern, also für die territoriale Aufteilung der Sowjetunion zu agitieren. Die Ukraine war allerdings für die Sowjetunion im Kriegsfall ein Gebiet von überlebenswichtiger Bedeutung: Aufgrund ihrer enorm fruchtbaren Schwarzerdeböden war die Ukraine immer der wichtigste Nahrungslieferant des russischen Zarenreichs gewesen und war dies auch für die Sowjetunion. Die zeitweilige Besetzung der Ukraine durch konterrevolutionäre weiße Truppen im Russischen Bürgerkrieg hatte in Russland eine schwere Hungersnot ausgelöst.
Zudem ließen sich manche Äußerungen Trotzkis so interpretieren, dass er sich eine militärische Niederlage der Roten Armee gegen eine zukünftige Invasion herbeiwünschte. Hitler werde den Krieg zwar schlussendlich verlieren – „Doch bevor er zum Hades fährt, könnte Hitler der UdSSR eine solche Niederlage zufügen, dass es die Kreml-Oligarchie den Kopf kostet.“ (Trotzki 1939a). Der Krieg könne also eine Revolution auslösen: So wie in Deutschland 1918 die Revolution ausbrach, „genauso kann der gegenwärtige Krieg zum Sturz der Kremlbürokratie führen, lange bevor die Revolution in irgendeinem der kapitalistischen Länder ausbricht“ (Trotzki 1939b). Dass eine solche „Revolution“ gegen das Sowjetsystem und die KPdSU zwangsläufig die Form eines bewaffneten Aufstands annehmen würde, hatte Trotzki schon Jahre zuvor offen ausgesprochen. Und einen solchen Bürgerkrieg wünschte Trotzki sich ausgerechnet im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Krieg der Sowjetunion gegen das Deutsche Reich. Vor diesem Hintergrund musste die sowjetische Führung die Haltung Trotzkis als zutiefst feindselig und objektiv im Dienst der faschistischen Mächte wahrnehmen – und das zurecht.
Es existieren auch handfeste Indizien dafür, dass Trotzkis Verbündete in der UdSSR aktiv die Produktion sabotierten: Zwei US-amerikanische Ingenieure, John D. Littlepage und Carroll G. Holmes arbeiteten seit Anfang der 1930er für einige Jahre in der Sowjetunion. Nach ihrer Rückkehr in die USA berichteten sie in der US-Presse von verheerenden Sabotageakten, die sie selbst erlebt hätten. Littlepage beschuldigte Juri Pjatakow, einen Verbündeten Trotzkis, sowie einen Trotzkisten namens Kabakow, bei mehreren Gelegenheiten die Produktion von Bergwerken absichtlich verringert zu haben und gezielt Methoden eingesetzt zu haben, die riesige Schäden an den Erzlagerstätten anrichteten. Später bemerkte Littlepage zu den Moskauer Prozessen, dass er den Anklagepunkt der Wirtschaftssabotage gegen Pjatakow für absolut plausibel hielt. Littlepage hatte keine politische Motivation für diese Aussage, er war nach Aussage vieler Zeitgenossen antikommunistisch gesinnt. Holmes machte in einem Maschinenbauwerk in Moskau ähnliche Beobachtungen: Es wurde bei weitem zu viel Maschinerie aus Deutschland angefordert sowie Maschinen für die es absolut keine Verwendung gab. Der Chefingenieur wurde auch hier von Pjatakow ernannt. In einer anderen Fabrik in Nischni Tagil habe Iwan Smirnow, ebenfalls einer der engsten Verbündeten Trotzkis in der Sowjetunion, Holmes dazu aufgefordert, die Produktion der Fabrik aufzuhalten (Martens 1998, S. 168ff: Furr 2015, S. 181-194). Wir wissen nicht mit absoluter Sicherheit, ob Trotzki in diese Aktionen verwickelt war. Wir wissen aber, dass in alle Sabotagefälle Anhänger Trotzkis involviert waren und dass Trotzki mit seinen Anhängern und Verbündeten in der Sowjetunion im geheimen Briefkontakt stand. Wir wissen auch, dass Trotzki gewaltsame Aktionen gegen die sowjetische Führung für legitim hielt. Es ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Trotzki darüber im Bilde war, dass seine Anhänger den Wirtschaftsaufbau und die Kriegsvorbereitungen der UdSSR sabotierten und dass er ihr Handeln entweder angeordnet hatte oder guthieß.
Trotzkis Zusammenarbeit mit den USA
Im Mai 1940 organisierte der kommunistische Maler David Alfaro Siqueiros in Mexiko einen Anschlag auf Trotzkis Leben, den dieser aber überlebte. Trotzki hatte bereits davor angestrebt, in die USA zu reisen, um eine Rede vor dem Dies-Komitee zu halten. Das Dies-Komitee war ein 1937 gegründeter Ausschuss des Kongresses der USA, das sich vor allem der Verfolgung von Kommunisten widmete und später in „Komitee für unamerikanische Umtriebe“ umbenannt wurde – nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zu einem Hauptinstrument der Kommunistenverfolgung in den USA. Vor diesem Komitee wollte Trotzki eine Rede gegen die Sowjetunion und die kommunistische Weltbewegung halten. Was er dabei an internen Informationen über kommunistische Organisationsstrukturen preisgegeben hätte, wissen wir nicht, denn zu der Rede kam es nicht.
Nach dem gescheiterten Anschlag hatte Trotzki nun eine zusätzliche Motivation, sich um ein Visum in die USA zu bemühen, da er davon ausgehen musste, dass Mexiko nicht mehr sicher für ihn war, während es in den USA zahlreiche Trotzkisten und sonstige Unterstützer Trotzkis gab. Er begann nun, mit den US-amerikanischen Behörden zu kooperieren, wahrscheinlich, um im Austausch ein solches Visum zu erhalten. Wir wissen, dass Trotzki sich mehrfach mit Mitarbeitern des Konsulats der USA in Mexiko traf und dass über einen Agenten Trotzkis namens Hansen Dokumente mit Informationen über Kommunisten aus Mexiko, Frankreich und den USA an das Konsulat gelangten. Auf einem Treffen mit dem Konsulatsmitarbeiter McGregor informierte Trotzki die US-Behörden auch über angebliche oder tatsächliche Agenten des sowjetischen Geheimdienstes. Diese Informationen gelangten ans State Department und schließlich an das FBI (Chase 1995). In den Monaten vor seinem Tod agierte Trotzki somit als Informant der US-amerikanischen Repressionsbehörden. Auch Diego Rivera, Trotzkis Gastgeber in Mexiko und Anhänger seiner Ideen, arbeitete in dieser Zeit nachweislich als Informant des State Department gegen die Kommunistische Partei Mexikos (PCM): Rivera lieferte den USA Informationen über die Finanzierungsmethoden der PCM. Er nannte zahlreiche Namen spanischer Kommunisten, die nach dem Sieg des Faschismus in Spanien nach Mexiko geflohen waren und nun laut Rivera Aktivitäten gegen die USA entwickelten. Und er lieferte auch Informationen über die Koordination der Aktivitäten der PCM mit der Komintern (Orgambides 1993). Dass Trotzki über die Aktivitäten seines Gastgebers Bescheid wusste und dass es zwischen den beiden eine Absprache gab, erscheint angesichts von Trotzkis eigener Informantentätigkeit sehr wahrscheinlich, Beweise dafür sind jedoch nicht bekannt.
Am Ende seines Lebens hatte Trotzki sich damit vom Führer einer opportunistischen Strömung in der Arbeiterbewegung zu einem offenen Verräter und Konterrevolutionär entwickelt, der mit dem US-Imperialismus gegen die kommunistische Bewegung zusammenarbeitete und im Angesicht der faschistischen Gefahr trotzdem in der UdSSR den Bürgerkrieg und gewaltsamen Sturz der sowjetischen Führung vorbereitete. Er starb am 21. August 1940 durch ein zweites, diesmal erfolgreiches Attentat des spanischen Kommunisten Ramón Mercader.
3. Die Theorie des Trotzkismus
Aufgrund welcher Auffassungen, welcher theoretischen Annahmen verwandelte Trotzki sich von einem Revolutionär, der trotz seiner immer vorhandenen opportunistischen Tendenzen eine wichtige Rolle in der sozialistischen Revolution gespielt hatte, in einen Konterrevolutionär, der mit imperialistischen Kräften gegen die kommunistische Bewegung zusammenarbeitete? Dazu müssen wir uns seine Positionen auf drei Gebieten ansehen, die auch für den Trotzkismus bis heute eine wichtige Rolle spielen: Trotzkis Auffassung von der Partei, seine Kritik der „Bürokratie“ und seine Behauptung, dass die Sowjetunion und Komintern unter Stalins Führung die Weltrevolution „verraten“ hatten.
3.1 Trotzki gegen Lenin: Die Frage des Demokratischen Zentralismus
Einer der Bereiche, in denen der Trotzkismus konkret in der Praxis andere Positionen vertritt als der Marxismus-Leninismus, ist der der Organisationspolitik, also der Frage nach der Organisationsform der Kommunisten. Während sich auch Trotzkisten heute in der Regel auf den Demokratischen Zentralismus berufen, ist das Verständnis davon oftmals ein anderes. Diese Differenzen gehen zum großen Teil bereits auf Trotzki zurück.
Frühe Auseinandersetzungen mit Lenin um die Organisationsfrage
1903 spaltete sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands (SDAPR), die Arbeiterpartei im russischen Zarenreich, in einen Minderheitenflügel (Menschewiki) und den Mehrheitsflügel (Bolschewiki) unter Führung Lenins. Ausschlaggebend war vor allem die Frage der Organisationsform: Lenin schrieb in diesem Kontext seine wichtige Broschüre „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“ (Lenin 1904, S. 197-430), in der er erklärte, warum die revolutionäre Partei eine disziplinierte Kaderpartei sein müsse. Um Mitglied zu werden, müsse man in einer Parteiorganisation aktiv sein. Die Partei müsse nach dem Demokratischen Zentralismus organisiert sein, also auf der freien Diskussion, demokratischen Beschlussfassung und Rechenschaftspflicht bei Verbindlichkeit der gefällten Beschlüsse basieren. Die Menschewiki hingegen wollten, dass jeder, der die Partei unterstützt und sich ihr selbst zurechnet, Mitglied der Partei werden könne.
Trotzki schlug sich bei der Spaltung auf die Seite der Menschewiki. In seiner Schrift „Unsere politischen Aufgaben“ von 1904, die er seinem „teuren Lehrer Pawel Borisowitsch Axelrod“, dem Führer der Menschewiki, widmete, griff er Lenin auf das Schärfste an. Lenin sei nicht nur der „Führer des reaktionären Flügels unserer Partei“, sondern er verwende den Marxismus auch als „Putzlumpen, wenn es gilt sich die Füße abzuwischen, eine weiße Leinwand, wenn er davor seine Größe demonstrieren möchte, ein zusammenklappbarer Meßstab, wenn er sein Parteigewissen vorzeigen muss.“
Lenins Parteikonzept laufe auf eine „Praxis der politischen Substitution“ hinaus, wobei die Partei „anstelle des Proletariats“ handele und sich einer „Übernahme des Denkens für das Proletariat“ schuldig mache. „In der inneren Politik der Partei führen diese Methoden, wie wir noch sehen werden, dazu, dass die Parteiorganisation die Partei selbst, das ZK die Parteiorganisation und schließlich ein Diktator das ZK ersetzt“. Trotzki glaubte also, dass nach dem von Lenin propagierten Demokratischen Zentralismus die Partei von einer allmächtigen Spitze regiert werde, während die Parteibasis zu passiven Befehlsempfängern degradiert werde: „Die ‚Organisation der Berufsrevolutionäre‘, genauer noch ihre Spitze, erscheint als das Zentrum sozialdemokratischen Bewusstseins, und unterhalb dieses Zentrums befinden sich die disziplinierten Exekutoren technischer Funktionen“.
Trotzkis eigene Vorstellungen darüber, wie die Partei der Arbeiterklasse aufgebaut sein sollte, lassen sich zum einen daraus schließen, dass er die Position der menschewistischen Führer Axelrod und Martow verteidigte. Zum anderen schreibt er selbst dazu: „Unsere Partei jedoch wird unbezweifelbar, mit welchem Radius wir unser Grenzgebiet auch abstecken, immer eine Reihe konzentrischer Gürtel des Proletariats darstellen, die vom Zentrum in Richtung Peripherie an Zahl zu- und an Bewusstheit abnehmen. Die bewusstesten, d. h. die revolutionärsten Elemente werden in unserer Partei ‚immer in der Minderheit‘ sein. Und wenn wir uns mit diesem Zustand ‚versöhnen‘ – und wir versöhnen uns mit ihm –, so kann das nur durch unser Vertrauen auf das sozialrevolutionäre ‚Schicksal‘ der Arbeiterklasse erklärt werden, anders gesagt, durch das Vertrauen auf die unvermeidliche ‚Erwerbung‘ revolutionärer Ideen als der am meisten ‚geeigneten‘ für die historische Bewegung des Proletariats.“ (alle Zitate aus Trotzki 1904: Über unsere politischen Aufgaben). Es ist offensichtlich, dass Trotzki sich keine Kaderorganisation von bewussten Revolutionären vorstellte, sondern vielmehr eine breite Massenpartei, die auch Arbeiter mit gering ausgeprägtem Klassenbewusstsein zu Mitgliedern macht. Und diese Parteikonzeption begründet er damit, dass die Arbeiterklasse gewissermaßen automatisch irgendwann zum revolutionären Bewusstsein kommen würde und es daher nicht schade, wenn die Partei mehr oder weniger die gesamte Klasse in sich aufnehme.
Trotzkis Position zur Organisationsfrage ist falsch und sie ist zutiefst antileninistisch. Der Demokratische Zentralismus und das Prinzip der Kaderpartei dienen keineswegs dazu, die kommunistische Partei in einen autoritären Apparat zu verwandeln, in dem die Führung alles alleine entscheidet und die Partei der Arbeiterklasse von oben Anweisungen gibt. Diese Kritik Trotzkis deckt sich im Kern mit den Vorwürfen, die bürgerliche Antikommunisten regelmäßig gegen den Leninismus erheben. Doch wenn die Bolschewiki tatsächlich eine solche Partei gewesen wären, hätten sie sicherlich keinen massenhaften Einfluss auf die Arbeiterklasse gewinnen und sie schon gar nicht siegreich in der Revolution führen können. Tatsächlich ist der Demokratische Zentralismus eine Organisationsform, die sowohl das Treffen schneller und fundierter Entscheidungen und die Zentralisierung von Erfahrungen ermöglicht als auch das Führen demokratischer Diskussionen in der Gesamtpartei und die Kontrolle der gewählten Leitungen durch ständige Rechenschaftspflicht und den Wahlprozess ermöglicht. Eine breite Massenpartei ohne festen Zentralismus, wie von Trotzki angestrebt, ist dagegen in Wirklichkeit viel undemokratischer. Ohne klare Beschlussdisziplin und Rechenschaftspflicht verlieren demokratische Entscheidungen ihre Bedeutung, da aus ihnen alles oder auch nichts als Konsequenz folgen kann. Und eine Partei, die sich in „konzentrischen Gürteln“ auf die ganze Arbeiterklasse erstreckt und in der die bewusstesten Elemente in der Minderheit sind, wird ihre Strategie und Taktik de facto nur mit einem kleinen Teil ihrer Mitglieder erarbeiten können, da dem Rest dazu die Voraussetzungen fehlen. Die Mitglieder der Partei werden also ungleich behandelt, ohne dass dies durch eine klare formale Unterscheidung wie die zwischen Mitgliedern und Sympathisanten gerechtfertigt wäre.
Die Konsequenz daraus, dass er mit seiner opportunistischen Position auf dem Parteitag in die Minderheit geriet, bestand für Trotzki jedenfalls einfach darin, die Parteidisziplin zu ignorieren – ein Muster, das sich in Zukunft noch oft wiederholen würde: „Wenn auf dem Weg zu diesem Ziel die ‚Minderheit‘ das verletzen muss, was die ‚Mehrheit‘ für Disziplin hält, dann bleibt nur der Schluss: Sie gehe zugrunde, diese Disziplin, die die lebendigen Interessen der Bewegung unterdrückt!“ (ebenda).
Das Fraktionsverbot in der bolschewistischen Partei
Kurz vor der Oktoberrevolution im Jahre 1917 trat Trotzki mit seinen Anhängern nun dennoch den Bolschewiki bei und sprach nun nicht mehr gerne über seine früheren radikalen Differenzen zu Lenins Parteikonzeption. Doch hatte er seinen Fehler wirklich eingesehen und Lenins Auffassung in der Organisationsfrage übernommen? Daran ist zu zweifeln. Denn mit den Auseinandersetzungen über das 1921 beschlossene Verbot der Fraktionsbildung innerhalb der Partei zeigte sich erneut Trotzkis gespanntes Verhältnis zum Demokratischen Zentralismus.
In „Verratene Revolution“ schreibt Trotzki 1936 über das Fraktionsverbot: „Das Fraktionsverbot war ebenfalls nur als außerordentliche Maßregel gedacht, die bei erster ernstlicher Besserung der Lage hinfällig werden sollte. (…) Allein, was anfänglich nur als erzwungener Tribut an die schwierigen Umstände gegolten hatte, war ganz nach dem Geschmack der Bürokratie, die das innere Leben der Partei ausschließlich vorn Standpunkt der Bequemlichkeit für die Leitung zu betrachten begann.“ (Trotzki 1936, Kapitel 5). Trotzki hatte 1921 selbst für das Fraktionsverbot gestimmt, nun setzte er es mit einem Denk- und Diskussionsverbot innerhalb der Partei gleich. Was hatte sich zwischen 1921 und 1936 geändert, dass Trotzki eine solche 180-Grad-Wende vollzog? Offensichtlich vor allem die Tatsache, dass Trotzki 1921 selbst Teil der Parteiführung war und 1936 nicht mehr. Trotzki war also gegen die Fraktionsbildung in der Partei, solange er selbst die Partei mit anführte. Er sprach sich für das „Recht“ auf Fraktionsbildung aus, sobald es seinen Interessen diente. Um diese Haltung zu rechtfertigen, behauptete er, das Fraktionsverbot sei 1921 nur eine vorübergehende Maßnahme gewesen. Diese Behauptung wird von Trotzkisten auch heute noch immer wieder aufgestellt. Im Parteibeschluss zum Fraktionsverbot, der „Resolution des X. Parteitags der KPR über die Einheit der Partei“, deutet jedoch nicht das Geringste auf eine solche Interpretation hin. Nicht nur taucht das Wort „vorübergehend“ nirgendwo auf, sondern die gesamte Argumentation des Beschlusses deutet in eine ganz andere Richtung. Darin lesen wir, dass jede Form der Fraktionsbildung „in der Praxis unweigerlich dazu führt, daß die einmütige Arbeit geschwächt wird und daß die Feinde, die sich an die Regierungspartei heranmachen, erneut verstärkte Versuche unternehmen, die Zerklüftung zu vertiefen und sie für die Zwecke der Konterrevolution auszunutzen“ (Lenin 1921d, S. 245). Kritik an den Mängeln der Partei sei weiterhin unbedingt notwendig, sie dürfe allerdings nicht „vorher in Gruppen erörtert werden, die sich auf Grund-irgendeiner ‚Plattform‘ u. ä. bilden, sondern sind ausschließlich der unmittelbaren Behandlung durch alle Parteimitglieder zuzuleiten“ (ebenda, S. 247). Es gehe dabei um die „Verwirklichung der Willenseinheit der Avantgarde des Proletariats, als der Grundbedingung für den Erfolg der Diktatur des Proletariats“ (ebenda, S. 246), da die Erfahrung früherer Revolutionen zeige, dass die Konterrevolution die Opposition immer ausnutze, um die Revolution zu stürzen. Die Argumentation bezieht sich also nicht auf eine vorübergehende Situation, sondern ist grundsätzlicher Natur: Für die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats müsse die organisierte Avantgarde, die kommunistische Partei, einheitlich auftreten und dürfe der Konterrevolution keine Möglichkeit geben, die Geschlossenheit des revolutionären Lagers zu unterminieren. Kritik müsse mit allen Parteimitgliedern diskutiert werden und nicht in exklusiven Gruppen.
An diese Vorgabe hielt Trotzki sich allerdings nur solange, wie es seinen Interessen entsprach. Wir haben bereits gesehen, wie Trotzki im Verlauf der innerparteilichen Auseinandersetzungen das Fraktionsverbot, das er ja nur als „vorübergehend“ und damit nicht bindend betrachtete, immer wieder brach, bis er deshalb aus der Partei ausgeschlossen wurde.
Trotzkis Haltung zum Fraktionsverbot stand in Kontinuität zu seinen schon früher geäußerten Auffassungen zur Organisationsfrage. Sie war Ausdruck seines Opportunismus in Organisationsfragen und seiner problematischen Haltung zum Demokratischen Zentralismus. Das Fraktionsverbot in den kommunistischen Parteien war eine logische Konsequenz aus den Erfahrungen der Klassenkämpfe und der proletarischen Revolution in Russland. Es war eine Weiterentwicklung der Prinzipien des Demokratischen Zentralismus, wie Lenin und die Bolschewiki ihn in den vorangegangenen Jahren ausgearbeiteten hatten. Es wurde damit selbst zu einem der wichtigsten Prinzipien des Demokratischen Zentralismus und wurde deshalb folgerichtig im Zuge der Bolschewisierung der kommunistischen Parteien überall durchgesetzt. Mit einem Verbot der innerparteilichen Kritik oder der Diskussion, wie Trotzki es darstellte, hat und hatte es nichts zu tun. Vielmehr ging es dabei immer darum, wie diese Kritik geäußert und die Diskussion darum geführt werden kann, ohne dass die innerparteiliche Demokratie und Transparenz untergraben werden, oder die Kräfte des Klassengegners die Möglichkeit bekommen, die Partei anzugreifen. Denn die Bildung von organisierten Gruppen oder „Plattformen“ innerhalb einer demokratisch-zentralistisch aufgebauten Partei bedeutet keineswegs einen Zuwachs an demokratischer Mitbestimmung. Vielmehr bedeutet es, dass einzelne Parteimitglieder oder Gruppen sich anmaßen, außerhalb der dafür vorgesehenen Strukturen – und das heißt eben unter Ausschluss anderer Parteimitglieder – Standpunkte zu erarbeiten und eine eigene, von der Parteidisziplin abweichende Disziplin zu entwickeln. Die Fraktionsbildung in der kommunistischen Partei verhindert, dass Standpunkte im Gesamtkollektiv der Partei und den dafür gewählten und rechenschaftspflichtigen Organen entwickelt werden. Sie führt dazu, dass Genossen sich nicht mehr als Gleiche gegenübertreten, sondern sich ein Klima der Bevorzugung und des Misstrauens entwickelt, dass inhaltliche Meinungsverschiedenheiten nicht gelöst werden, sondern sich verfestigen. Sie setzt an die Stelle des Prinzips der Offenheit der Diskussion die Intrige, die Doppelzüngigkeit und Unehrlichkeit, das gegenseitige Misstrauen. Sie untergräbt damit die Einheit der proletarischen Partei und nützt der Bourgeoisie, die jeden Riss innerhalb der Partei ausnutzen und vertiefen wird, um sie zu schwächen. Bis heute lehnen Trotzkisten in der Regel das Fraktionsverbot ab. Insofern der Trotzkismus bis heute als Fürsprecher des Fraktionismus auftritt, wirkt er objektiv zersetzend auf die kommunistische Bewegung und steht im Widerspruch zu ihren Prinzipien. Auch die Geschichte der trotzkistischen Bewegung selbst, die so sehr von permanenten Spaltungen gekennzeichnet ist wie keine andere Strömung der Arbeiterbewegung, zeigt das.
Der „Entrismus“
Eine weitere Frage, bei der Trotzki sich in einen Gegensatz zur leninistischen Parteitheorie begibt, ist schließlich die des „Entrismus“. Entrismus bezeichnet die Taktik trotzkistischer Organisationen, in sozialdemokratische oder manchmal auch kommunistische Parteien einzudringen. Das Ziel dabei kann einerseits darin bestehen, die Politik dieser Parteien im trotzkistischen Sinne zu beeinflussen und andrerseits darin, Einfluss auf die Mitgliederbasis der Parteien auszuüben und sie für den Trotzkismus zu gewinnen. Der Entrismus wird in verschiedenen Formen bis heute von vielen, wenn auch nicht allen, trotzkistischen Gruppen angewandt: International spielen das Committee for a Workers‘ International (CWI) und die International Marxist Tendency (IMT) hier eine wichtige Rolle, in Deutschland zudem das Netzwerk „Marx21“.
Trotzki selbst hatte den Entrismus erstmals 1934 in Bezug auf die französische sozialdemokratische Partei SFIO vorgeschlagen, woraufhin die französischen Trotzkisten in diese eintraten, um Einfluss auf die Parteibasis zu gewinnen. Für Trotzki war der Entrismus dabei nur eine vorübergehend angelegte Konzeption: „Der Eintritt in eine reformistische, zentristische Partei, beinhaltet an sich keine lange Perspektive“ (zitiert nach: Klasse gegen Klasse 2013). Daher kann sich die Praxis einiger trotzkistischer Organisationen, seit Jahrzehnten die sozialdemokratischen Parteien zu unterwandern, damit schwerlich auf Trotzki berufen. Faktisch gibt es die Praxis des Entrismus auch bei nichttrotzkistischen Organisationen, die z.B. aufgrund der Schwäche der kommunistischen Parteien auf eine Mitgliedschaft in der „linken“ Sozialdemokratie orientieren (beispielsweise die der türkischen EMEP nahestehende DIDF in Deutschland). Es gibt auch Fälle, in denen marxistisch-leninistische Parteien ihre Mitglieder z.B. unter Bedingungen der Illegalität anwiesen, in reformistische Parteien einzutreten.
Doch wie ist der Entrismus grundsätzlich einzuschätzen? Er ist grundsätzlich eine falsche Praxis, auch und gerade dann, wenn er von ehrlichen Revolutionären angewandt wird. Er führt dazu, dass der grundsätzliche Gegensatz zwischen Revolutionären und Reformisten verwischt wird. Er bedeutet, dass man den Aufbau der reformistischen Partei mit unterstützen muss, um sich Respekt zu verdienen, und dass man nach außen als Mitglied der reformistischen Partei auftritt. Für die unorganisierte Arbeiterklasse ist der grundlegende Gegensatz zwischen dem reformistischen und dem revolutionären Programm dadurch nicht mehr ersichtlich. Auf den Aktivisten, die in revolutionärer Absicht entristisch handeln, lastet dabei eine schwere Verantwortung, denn sie tragen dazu bei, dass Arbeiter mit linken Phrasen in die Arme der Sozialdemokratie getrieben, also in die Irre geführt werden. Zudem bedeutet der Entrismus zwangsläufig, dass viel Zeit und Energie in die Arbeit innerhalb der reformistischen, also bürgerlichen Organisationsstrukturen investiert wird, die damit also nicht in den Aufbau einer eigenständigen Partei der Arbeiterklasse fließen kann. All das ist mit den Aufgaben eines Revolutionärs grundsätzlich unvereinbar. Selbst wenn es ansonsten keine großen inhaltlichen Differenzen mit den trotzkistischen Organisationen gäbe, wäre der Entrismus also bereits ein großer Kritikpunkt.
Trotzkis Befürwortung des Entrismus steht, wie auch seine Haltung zum Fraktionsverbot, in Kontinuität zu seinen grundsätzlichen opportunistischen Auffassungen zur Organisationsfrage. Sie hängt erstens zusammen mit seiner 1904 vertretenen Parteiauffassung, die er offenbar nie ganz aufgegeben hatte: Da er bereits die SDAPR als breite Massenpartei aufbauen wollte, in der eine revolutionäre Minderheit Einfluss auf die nur diffus politisierte Masse der Mitglieder nimmt, erscheint es nur folgerichtig, dass er später den kleinen trotzkistischen Gruppierungen empfahl, als eine solche „revolutionäre Minderheit“ innerhalb der sozialdemokratischen Massenparteien zu agieren. Zweitens hängt seine Position auch mit seiner Haltung gegenüber dem Reformismus zusammen. Trotzkis Haltung in der russischen Arbeiterbewegung war über viele Jahre zentristisch, indem er versuchte, das revolutionäre Lager der Bolschewiki mit dem reformistischen Lager der Menschewiki wieder zusammen zu bringen und die Differenzen zu überbrücken. Die Spaltung in Bolschewiki und Menschewiki war aber ebenso wie die späteren Spaltungen in sozialdemokratische und kommunistische Parteien eine wichtige Errungenschaft der Arbeiterbewegung. Erst dadurch erhielt die Arbeiterklasse ihre eigene Partei und eigene Führung zurück, die für ihre Befreiung kämpft, statt für die Akzeptanz des Ausbeutersystems. Trotzkis Auffassung, wonach die sozialdemokratischen Parteien weiterhin Arbeiterparteien darstellen, ist zudem falsch oder zumindest irreführend. Von ihrem Programm und ihrer Organisationspraxis her handelt es sich um bürgerliche Parteien. Deshalb ist die Einheit mit den sozialdemokratischen Parteien eine Zusammenarbeit der Arbeiterklasse mit der Bourgeoisie. Genau auf diesem Irrtum, dass es zwischen der Sozialdemokratie und den Kommunisten keinen klassenmäßigen Unterschied gäbe, beruht letztlich die Rechtfertigung des Entrismus.
Wir können also schlussfolgern, dass Trotzki in organisationspolitischen Fragen opportunistische, antileninistische Auffassungen vertrat, die bis heute die Praxis trotzkistischer Gruppierungen prägen.
3.2 Die Theorie der „stalinistischen Bürokratie“
Die Kritik der „stalinistischen Bürokratie“ ist eine zentrale Säule der Theorie des Trotzkismus, sie ist einer der Kernpunkte in Trotzkis gesamtem Werk. Der Kritik an der Bürokratie ist, verbunden mit dem Vorwurf an die Sowjetunion, die Weltrevolution verraten zu haben, der rote Faden, der sich durch seine Schriften zieht.
Die „stalinistische Bürokratie“ in Trotzkis Denken
Wie verstand Trotzki nun die „Bürokratie“?
Es handelte sich seiner Meinung nach um eine „herrschende Schicht“ oder „Kaste“, die in der Sowjetunion die politische Macht ausübte und die Arbeiterklasse unterdrückte. Eine herrschende Klasse im vollen Sinne des Wortes sei die Bürokratie jedoch nicht gewesen, wie Trotzki in verschiedenen Texten immer wieder betonte. Welchen Klassencharakter hatte die „Bürokratie“ dann? Wenn sie keine herrschende Klasse, keine Ausbeuterklasse war, wessen Interessen diente sie dann? Oder musste die Staatstheorie des Marxismus, wonach jeder Staat der Staat einer bestimmten Klasse ist, revidiert werden?
Trotzkis Überlegungen blieben gerade in diesen entscheidenden Fragen sehr unklar. Einerseits sei die Sowjetunion weiterhin ein Arbeiterstaat, da es keine neue herrschende Klasse gebe. Da aber der Arbeiterklasse die politische Macht entrissen worden sei, sei die Sowjetunion ein „degenerierter“ oder „deformierter“ Arbeiterstaat. Andrerseits beschreibt Trotzki die „Bürokratie“ an vielen Stellen trotzdem so, als würde er über eine herrschende Klasse sprechen.
Sie sei eine „sehr privilegierte befehlende Schicht (…), die sich den Löwenanteil auf dem Gebiete des Verbrauchs aneignet.“. Einkommensunterschiede innerhalb der sowjetischen Gesellschaft seien „nicht nur durch die Verschiedenheiten in der individuellen Arbeit bestimmt, sondern auch durch verschleierte Aneignung fremder Arbeit“. „Die neue soziale Schichtenbildung hat die Voraussetzungen zum Wiedererstehen der barbarischsten aller Formen der Ausbeutung des Menschen geschaffen“. Die Bürokratie sei also eine ausbeutende Schicht: „Stellte man die Regel, wonach Ausbeutung fremder Arbeitskraft den Verlust der politischen Rechte zur Folge hat, wieder her, so würde sich plötzlich herausstellen, dass die Elite der herrschenden Schicht die Schwelle der Sowjetverfassung nicht betreten könnte“. Trotzki gesteht zu, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln weitgehend überwunden war, aber: „Die Produktionsmittel gehören dem Staat. Aber der Staat ‚gehört‘ gewissermaßen der Bürokratie“. Das Wort „gewissermaßen“ soll hier wohl die Aussage abschwächen, dass der sowjetische Staat das „Eigentum“ der „Bürokratie“ sei. Man muss sich dann aber fragen, was Trotzki damit aussagen will: Gehört der Staat nun der „Bürokratie“ oder nicht? Ist die „Bürokratie“ nun über einen Umweg doch Eigentümer der Produktionsmittel, also eine neue Ausbeuterklasse, oder nicht? Zur „Bürokratie“ als „herrschender Schicht“ heißt es weiter: „Die Aneignung eines enormen Anteils am Volkseinkommen durch die Bürokratie ist soziales Schmarotzertum.“. Zudem besitze sie „das spezifische Bewusstsein der herrschenden ‚Klasse‘“, auch wenn dieses „von der Überzeugtheit von ihrem Recht auf die Herrschaft noch weit entfernt ist.“ (Trotzki 1936). Nach Trotzkis Beschreibung erfüllt die „Bürokratie“ damit alle Kennzeichen einer herrschenden Ausbeuterklasse: Sie hat die politische Macht inne, sie eignet sich den „Löwenanteil“ des produzierten Reichtums an. Vor allem aber basiert ihre soziale Stellung nicht nur auf dem unterschiedlichen Charakter der Arbeit, sondern auf der Aneignung fremder Arbeit, also auf Ausbeutung, weshalb es sich um „Schmarotzertum“ handle. Ist eine Gruppe von Menschen, die eine andere ausbeutet, nicht eine herrschende Klasse? Trotzki selbst vermied diese Schlussfolgerung immer, da die „Bürokratie“ nicht über privates Eigentum an Produktionsmitteln verfügte. Doch da er dem an anderen Stellen ständig widerspricht, wird nicht klar, warum er die eigentliche Konsequenz seiner Ausführungen nicht aussprach: Nämlich dass die „Bürokratie“ eine neue herrschende Klasse, eine neue Bourgeoisie sei. Diejenigen unter Trotzkis Nachfolgern, die die Sowjetunion kurzerhand als „staatskapitalistisch“ bezeichneten, waren damit konsequenter als Trotzki selbst – und lagen damit auch noch falscher als er.
Lenin und Stalin zur Frage der Bürokratie
Warum ist Trotzkis Analyse der „stalinistischen Bürokratie“ falsch?
Vergleichen wir Trotzkis Auffassungen zunächst mit denen Lenins: Trotzkis Analyse der sogenannten „Bürokratie“ in der Sowjetunion unterschied sich grundlegend von der Lenins und Stalins. Sowohl Lenin als auch Stalin hatten immer wieder vor bürokratischen Auswüchsen im Verwaltungsapparat und der Partei gewarnt, jedoch hatten sie nie den gesamten Apparat oder die gesamte Partei an sich für eine bürokratische Entartung gehalten. Trotzki hingegen verzichtete auf die Differenzierung zwischen revolutionären Kräften in der Verwaltung und Staatsführung einerseits und bürokratischen, hemmenden und konservativen Elementen andrerseits (vgl. Kubi 2019).
So ist auch Lenin der Ansicht, dass es in der Sowjetunion „bürokratische Auswüchse“ gebe. Die Gründe dafür sieht er jedoch in objektiven Faktoren, die sich nicht ohne Weiteres, sondern nur über längere Zeiträume im sozialistischen Aufbau überwinden lassen: „Wenn man hier vor Ihnen auftritt und sagt: ‚machen wir Schluß mit dem Bürokratismus‘, so ist das Demagogie: Das ist dummes Zeug. Gegen den Bürokratismus werden wir noch lange Jahre zu kämpfen haben, und wer anders darüber denkt, der treibt Scharlatanerie und Demagogie, denn um den Bürokratismus niederzuringen, braucht man Hunderte von Maßnahmen, braucht man allgemeine Bildung, allgemeine Kultur, allgemeine Teilnahme an der Arbeiter- und Bauerninspektion“ (Lenin 1921b, S. 42; 54). Für Lenin ergab sich die Gefahr des Bürokratismus aus dem niedrigen Entwicklungsstand der sowjetischen Gesellschaft. Sie war nicht die Schuld einer Clique oder Kaste, die die Kontrolle über die Partei übernommen hatte.
Stalin folgte der Ansicht Lenins und zog ähnliche Schlussfolgerungen daraus. „Die Hauptsache ist jetzt, gegen den Bürokratismus überhaupt, gegen die Mängel in unserer Arbeit insbesondere, eine breite Welle der Kritik von unten auszulösen. Nur wenn wir erreichen, dass der Druck von zwei Seiten erfolgt – sowohl von oben als auch von unten -, nur wenn das Schwergewicht auf die Kritik von unten verlegt wird, wird man auf Erfolge im Kampf und auf die Ausrottung des Bürokratismus rechnen können. (…) Die Massenkritik von unten, die Kontrolle von unten brauchen wir unter anderem deshalb, damit diese Erfahrungen der Millionenmassen nicht verloren gehen, damit sie berücksichtigt und in die Tat umgesetzt werden“ (Stalin 1928a, S. 65f). So argumentiert Stalin in einem Redebeitrag, der am 17. Mai 1928 in der Parteizeitung „Prawda“ der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ähnliche Aussagen finden sich in zahlreichen anderen Texten Stalins: „Doch eins der ärgsten Hindernisse, wenn nicht das ärgste Hindernis überhaupt, ist der Bürokratismus unserer Apparate. Es handelt sich darum, dass innerhalb unserer Partei-, Staats-, Gewerkschafts-, Genossenschafts- und aller Art anderer Organisationen bürokratische Elemente vorhanden sind. Es handelt sich um die bürokratischen Elemente, die von unseren Schwächen und Fehlern leben, die die Kritik der Massen, die Kontrolle der Massen wie das Feuer fürchten und die uns hindern, die Selbstkritik zu entfalten, uns hindern, uns von unseren Schwächen, von unseren Fehlern zu befreien“ (Stalin 1928b, S. 116f). „Um jedoch die Millionenmassen „heranzuziehen“, gilt es, in allen Massenorganisationen der Arbeiterklasse und vor allem in der Partei selbst die proletarische Demokratie zu entfalten.“ (ebenda, S. 117). „Wir brauchen eine Selbstkritik, die das Kulturnievau der Arbeiterklasse hebt, ihren Kampfgeist entwickelt, ihren Siegesglauben festigt, ihre Kräfte vermehrt und ihr hilft, der wirkliche Herr des Landes zu werden.“ (ebenda, S. 117f). „Natürlich können wir nicht fordern, dass die Kritik hundertprozentig richtig ist. Wenn die Kritik von unten kommt, dürfen wir sogar eine Kritik, die nur zu 5-10 Prozent richtig ist, nicht unbeachtet lassen“ (ebenda, S. 122).
Stalin wandte sich explizit gegen Auffassungen anderer Genossen, die die Diktatur des Proletariats mit der Diktatur der kommunistischen Partei gleichsetzten. „Wer daher die führende Rolle der Partei mit der Diktatur des Proletariats identifiziert, der ersetzt die Sowjets, das heißt die Staatsmacht, durch die Partei“. (Stalin 1926, S. 37). Darin sieht er die Gefahr, dass sich daraus eine Diktatur der Partei über die Arbeiterklasse ergebe: „Spricht man daher von der Diktatur der Partei gegenüber der Klasse der Proletarier und identifiziert diese Diktatur mit der Diktatur des Proletariats, so sagt man damit, dass die Partei gegenüber ihrer Klasse nicht bloß Leiter, nicht bloß Führer und Lehrer sein müsse, sondern auch eine Art Diktator, der ihr gegenüber Gewalt anwendet, was natürlich grundfalsch ist. Wer daher die „Diktatur der Partei” mit der Diktatur des Proletariats identifiziert, der geht stillschweigend davon aus, dass man die Autorität der Partei auf Gewalt gegenüber der Arbeiterklasse aufbauen kann, was absurd und mit dem Leninismus völlig unvereinbar ist.“ (ebenda, S. 37f). Stattdessen müsse man den Sowjets, also den Arbeiter- und Bauernräten „die Beteiligung an der Einrichtung des neuen Staates und an seiner Verwaltung maximal erleichtern und die revolutionäre Energie, die Initiative, die schöpferischen Fähigkeiten der Massen im Kampf für die Zerstörung der alten Ordnung, im Kampf für die neue, proletarische Ordnung maximal zur Entfaltung bringen“ (Stalin 1924a, S. 105).
Durch die Reden, theoretischen Aufsätze und Zeitungsartikel Stalins zieht sich immer wieder das Thema des Kampfes gegen den Bürokratismus, gegen autoritäre Formen der Herrschaftsausübung von oben, gegen die Tendenz zum Ausschluss der Arbeiterklasse von der Macht. Wie kommt also Trotzki darauf, ausgerechnet Stalin zum Führer der Diktatur einer bürokratischen Kaste zu erklären, die die Arbeiterklasse entmachtet hätte? Waren Stalins Aussagen zu dem Thema vielleicht nur Lippenbekenntnisse?
Eine solche These wäre nicht sehr plausibel, denn Stalins Aussagen zu dem Thema genossen in der Sowjetunion natürlich großes Gewicht und wurden von Millionen Kommunisten als Anleitung in ihrer politischen Praxis wahrgenommen. Hätte Stalin also die Privilegien und die Macht einer bürokratischen Kaste schützen wollen, wäre er schlecht beraten gewesen, die Partei und Arbeiterklasse immer und immer wieder zum Kampf gegen sie aufzurufen.
Der Kampf gegen den „Bürokratismus“ in der Sowjetunion
Aber auch bürgerliche Historiker kommen zu ganz anderen Schlüssen als Trotzki. Lih, der Stalins interne Kommunikation mit Molotow analysiert hat, schließt aus dem Quellenmaterial, dass für Stalins Politik ein „antibürokratisches Szenario“ handlungsleitend war: Demnach ging Stalin davon aus, dass die Bedingungen für den Sozialismus in der Sowjetunion bereits existierten, aber die Herausforderung zu meistern hatte, dass der Staatsapparat sich noch auf viele bürgerliche Spezialisten und Verwaltungspersonal ohne tiefe revolutionäre Überzeugungen stützen musste (Lih u.a., 1995, S. 11). Auch die bürgerlichen Historiker Arch Getty und Oleg Naumov sehen die Regierungszeit Stalins davon geprägt, dass die Parteiführung versuchte, die Verfestigung einer bürokratischen Schicht zu bekämpfen, wobei sie auch die Repressionen der 1930er Jahre als ein Instrument in diesem Kampf verstehen (Getty/Naumov 1999, S. 585f).
Getty analysiert zudem, wie Stalin und andere Parteiführer in den 1930ern einen innerparteilichen Kampf darum führten, in der neuen sowjetischen Verfassung von 1936 eine Reform des Wahlsystems durchzusetzen. Der Verfassungsentwurf wurde am 12.6.1936 in der Presse veröffentlicht und dann in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Zahlreiche einfache Bürger diskutierten in Artikeln und Berichten über die Vor- und Nachteile der neuen Verfassung, was von der sowjetischen Führung sehr ernst genommen und verfolgt wurde. Dabei wurden viele Parteifunktionäre für bürokratisches Vorgehen kritisiert. Bis zum Herbst 1936 nahmen etwa 51 Millionen Sowjetbürger auf etwa 500.000 öffentlichen Veranstaltungen an Diskussionen über die Verfassung teil, auf denen viele Änderungsvorschläge gemacht und Kritikpunkte geäußert wurden (Getty 1991, S. 23f). Die Erarbeitung der neuen Verfassung war damit als Prozess mit breiter Massenbeteiligung konzipiert. Ein Kernpunkt in der Verfassung selbst war die Frage des Wahlrechts. Stalin und einige Genossen der Parteiführung wie Andrej Schdanow und Michail Kalinin sprachen sich stark für ein allgemeines Wahlrecht aus, wobei es bei den Wahlen konkurrierende Kandidaten geben sollte, die gegeneinander antreten würden. Bei den bisherigen Wahlen hatte es zwar im Auswahlverfahren der Kandidaten Möglichkeiten für die Wähler gegeben, die vorgeschlagenen Kandidaten durch andere zu ersetzen, aber beim Wahlprozess selbst war nur noch eine Stimme für oder gegen einen bestimmten Kandidaten möglich. Das sollte sich nun ändern. 1937 wurden in der Partei Wahlen mit mehreren Kandidaten abgehalten (ebenda, S. 33). Für die Wahlen zu den Sowjets konnte sich die von Stalin angestrebte Änderung jedoch nicht durchsetzen. Der wesentliche Grund dafür war laut Getty, dass viele lokale und regionale Funktionäre sich vor einer Ausweitung der demokratischen Partizipation fürchteten (ebenda, S. 29ff). „Über die nächsten paar Monate taten lokale Parteiführer alles was sie innerhalb der Grenzen der Parteidisziplin (und manchmal außerhalb derselben) tun konnten, um die Wahlen zu blockieren oder zu verändern.“ (Getty 2002, S. 126) Im Zuge der Verfassungsdiskussion waren viele Funktionäre aus der Bevölkerung scharf kritisiert worden und die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch andere Personen ersetzt worden wären, war in vielen Fällen sicherlich nicht aus der Luft gegriffen.
Diese mittlere Schicht der Funktionäre besser von unten zu kontrollieren, wie Stalin es in früheren Reden und Artikeln bereits eingefordert hatte, war ein zentrales Ziel der Wahlrechtsreform. Aufgrund des erbitterten Widerstands dieser Funktionäre konnte sich die Parteiführung in diesem Punkt jedoch nicht durchsetzen. An dieser Stelle ist entscheidend zu betonen, dass Stalin und andere Parteiführer versuchten, die Macht und Verselbstständigung des bürokratischen Apparats einzuschränken, indem sie die Kontrolle von unten zu stärken versuchten. Stalin war also keineswegs der Vertreter einer herrschenden bürokratischen Schicht, sondern ähnlich wie Lenin sah er die Tendenzen zum Bürokratismus, also zur Lösung politischer Konflikte durch bürokratische Methoden und zur Verselbstständigung der Apparate, als ernsthaftes Problem im Aufbau des Sozialismus an, dem nur mithilfe der Kritik und Partizipation der Volksmassen beizukommen sei.
Wir können aus dem bisher gesagten folgende Schlussfolgerungen ziehen:
Erstens ist Trotzkis Theorie der „Bürokratie“ eine falsche, unbrauchbare Analyse der sowjetischen Gesellschaft. Natürlich gab es in der UdSSR eine Schicht, die Aufgaben der Verwaltung, Planung, Leitung usw. übernahm. Diese hatte zum Teil eine bessere materielle Stellung als andere Teile der Gesellschaft und es gab in ihr Tendenzen zur Verselbstständigung und inkonsequenten Verfolgung revolutionärer Ziele. Doch eine parasitäre, ausbeutende Schicht war sie nicht. Und dass es solche Tendenzen gab, bedeutet noch lange nicht, dass das gesamte Leitungspersonal in Partei und Staat „bürokratisch entartet“ und die Partei selbst konterrevolutionär geworden war.
Zweitens ist Trotzkis Vorwurf gegen Stalin, wonach dieser der Kopf der „Bürokratie“ sei, absurd. Denn Stalin erkannte durchaus die Gefahren, die von einer Verselbstständigung und Degeneration der Bürokratie ausgingen und kämpfte jahrzehntelang gegen sie an.
Dass Trotzki aber gerade vehement darauf bestand, Stalin repräsentiere die Bürokratie, scheint sich eher dadurch zu erklären, dass er selbst nicht mehr Teil der Parteiführung war und nun eine theoretische Rechtfertigung brauchte, um seinen Gegner Stalin angreifen zu können. Diese Vermutung wird dadurch bestärkt, dass Trotzki selbst in den Jahren zuvor keineswegs als konsequenter Kämpfer gegen die Bürokratisierung aufgefallen war. Schließlich hatte Lenin in seinem sogenannten „Testament“ Trotzki ausgerechnet dafür kritisiert, eine „übermäßige Vorliebe für rein administrative Maßnahmen“ zu haben.
Diese Tendenz zeigte sich z.B. in Trotzkis Auseinandersetzung mit Lenin zur Gewerkschaftsfrage im Jahr 1921. Trotzki trat dafür ein, dass die Gewerkschaften im Sozialismus zu Apparaten des Staates zum Zwecke der Produktivitätssteigerung reduziert werden sollten. Die Aufgabe der Gewerkschaften, Formen der demokratischen Selbstorganisierung der Arbeiterklasse darzustellen und die Arbeiter gegebenenfalls auch vor dem eigenen Staat zu schützen, habe demgegenüber zurückzutreten: „Der Gewerkschaftler soll sich nicht als Anwalt der Nöte und Bedürfnisse der Arbeiter fühlen, sondern als Organisator der Werktätigen, bestimmt, die Produktion auf eine immer höhere technische Basis zu führen“. „Die Arbeiterdemokratie muss sich bewusst dem Produktionskriterium unterordnen.“. Trotzki forderte sogar eine „Verstaatlichung der Gewerkschaften“ in möglichst naher Zukunft (Trotzki 1921). Er trat in der Gewerkschaftsfrage somit nicht als scharfzüngiger Kritiker des Bürokratismus, sondern eher als dessen Vorreiter auf. Er wurde dafür zurecht von Lenin kritisiert (vgl. z.B. Lenin 1920: Über die Gewerkschaften, die gegenwärtige Lage und die Fehler Trotzkis, LW 32, S. 1-26). Gramsci erhob eine ähnliche Kritik gegen Trotzki. Dessen Vorstellung, „mit äußeren Zwangsmitteln die Disziplin und die Ordnung in der Produktion zu beschleunigen“, sei „von Grund auf falsch“, „daher die Notwendigkeit sie rücksichtslos zu unterbinden“ (Gramsci: Gefängnishefte, H 22, S. 2085).
Von der „Bürokratiekritik“ zur These des „Staatskapitalismus“
Trotzkis Analyse der Sowjetunion bestand also darin, dass die Sowjetunion ein „deformierter Arbeiterstaat“ unter der Herrschaft einer Bürokratie sei, aber kein „Staatskapitalismus“ mit einer neuen Bourgeoisie. Am Ende seines Lebens scheint Trotzki diese Position relativiert oder sogar infrage gestellt zu haben. In einem Text von 1939 spekuliert er darüber, wie der Charakter der UdSSR einzuschätzen wäre, wenn es dem Proletariat nicht gelingen sollte, eine „wahre“ sozialistische Revolution im Sinne Trotzkis durchzuführen und die Macht zu halten: „Dann würde es nötig werden, rückblickend festzustellen, dass die gegenwärtige UdSSR in den Grundzügen der Vorläufer eines neuen Ausbeuterregimes im internationalen Maßstabe war.“ (Trotzki 1939d). Dennoch sieht er die Sowjetunion nach wie vor noch nicht als Ausbeuterstaat oder neuen Kapitalismus an. Bleibt Trotzki hier also noch im Bereich des Hypothetischen, hören sich seine Ausführungen etwas später schon anders an. Der angebliche sowjetische „Thermidor“, also die Übernahme der Macht durch eine nicht mehr revolutionäre „Bürokratie“, beschreibt er folgendermaßen: „Sie war die Kristallisierung einer neuen privilegierten Schicht, die Schöpfung eines neuen Unterbaus für die ökonomisch herrschende Klasse. Zwei Anwärter auf diese Rolle waren vorhanden: das Kleinbürgertum und die Bürokratie selbst“ (Trotzki 1940, Nachtrag: I. Die thermidorianische Reaktion). Nachdem Trotzki jahrelang gegen die Position einiger seiner Anhänger argumentiert hatte, dass in der Sowjetunion eine neue Klasse entstanden sei, deutet er nun selbst an, es gebe eine ökonomisch herrschende Klasse in der Sowjetunion, die sich aus dem Kleinbürgertum und der „Bürokratie“ entwickeln könnte.
Wie das genau gemeint ist, führt Trotzki nicht weiter aus und natürlich wissen wir nicht, ob er in den folgenden Jahren zu einer „Staatskapitalismus“-Position übergegangen wäre.
Seine Frau allerdings, Natalja Sedowa, die auch eine enge politische Vertraute Trotzkis war, sah genau darin die logische Konsequenz aus Trotzkis Analysen. 1951 trat sie aus der von Trotzki gegründeten IV. Internationalen aus, weil diese die Sowjetunion weiterhin als Arbeiterstaat betrachtete. Das seien jedoch „alte und überlebte Formeln“. Denn: „So gut wie jedes Jahr (…) hat L. D. Trotzki wiederholt, dass das Regime sich nach rechts bewegt (…). Immer wieder wies er darauf hin, wie die Konsolidierung des Stalinismus in Russland zur Verschlechterung der ökonomischen, politischen und sozialen Lage der Arbeiterklasse und zum Triumph einer tyrannischen und privilegierten Aristokratie führte. Wenn dieser Trend sich fortsetzt, sagte er, wird die Revolution am Ende sein und die Wiederherstellung des Kapitalismus erreicht sein. Das ist leider das, was passiert ist, wenn auch in neuen und unerwarteten Formen.“. Die Sowjets, so Sedowa, seien nun „die schlimmsten und gefährlichsten Feinde des Sozialismus und der Arbeiterklasse“. (Sedova 1951).
Sedowas Argumentation, dass die Staatskapitalismusthese eine Weiterentwicklung von Trotzkis Bürokratiethese sei, ist durchaus plausibel, auch wenn diese „Weiterentwicklung“ dabei eher im Sinne einer fortschreitenden theoretischen Degeneration zu verstehen ist. Denn zum einen war Trotzkis Bürokratietheorie, wie oben gezeigt wurde, immer unklar in der Frage, welchen Klassencharakter die „Bürokratie“ eigentlich haben soll. Zum anderen stellte Trotzki, obwohl er die Sowjetunion noch als Arbeiterstaat sah, immer wieder Vergleiche mit dem Faschismus an. So verwende die Sowjetunion „die politischen Methoden des Faschismus“ (Trotzki 1939dc). Sie wird ganz im Stil der bürgerlichen antikommunistischen Propagandisten in Trotzkis Texten immer und immer wieder mit dem Etikett „totalitäre Diktatur“ und ähnlichen Bezeichnungen versehen. An einer anderen Stelle erklärt Trotzki, „daß die UdSSR minus der gesellschaftlichen Struktur, die sich auf die Oktoberrevolution gründet, ein faschistisches Regime wäre.“ (Trotzki 1939c). Das Verständnis von Gesellschaft, das hinter solchen Aussagen steht, hat mit dem des Marxismus offensichtlich wenig zu tun. Denn ganz abgesehen davon, dass die Gleichsetzung der Methoden der Sowjetunion mit denen der Nazis eine empörende Verfälschung der Tatsachen und Verharmlosung des Faschismus darstellt, setzen solche Formeln auch voraus, dass es irgendwie möglich wäre, das politische System unabhängig von der ökonomischen Grundlage zu sehen. In Wirklichkeit ergibt es keinerlei Sinn, die politische Struktur der Sowjetunion unabhängig von ihrer ökonomischen Basis zu betrachten, da sämtliche Formen der Massenmobilisierung und -partizipation, Entscheidungsstrukturen und Staatsapparate dazu geschaffen worden waren, den Erfordernissen einer vergesellschafteten und zentral geplanten, also einer sozialistischen Wirtschaft zu entsprechen.
Die Teile der trotzkistischen Bewegung, die die Sowjetunion als „degenerierten Arbeiterstaat“ bezeichnen, bestreiten oftmals, dass es sich bei den Anhängern der Staatskapitalismusthese ebenfalls um Trotzkisten handelt – schließlich hatte Trotzki diese Theorie ja immer abgelehnt. Tatsache ist jedoch, dass die Staatskapitalismus-Strömung sich trotzdem immer auf Trotzki berufen hat und ihre eigene „Analyse“ als eine Weiterentwicklung von Trotzkis Bürokratiethese verstanden hat. Wie hier gezeigt wurde, ist diese Argumentation der Staatskapitalismus-Strömung auch durchaus nachvollziehbar, da Trotzki die „Bürokratie“ an vielen Stellen so beschreibt, als wäre sie eine Ausbeuterklasse. Man kann daher beide Strömungen als zwei unterschiedliche Varianten des Trotzkismus begreifen: Während die eine sich auf Trotzkis verbale Ablehnung der Staatskapitalismusthese beruft, kann die andere sich darauf beziehen, dass Trotzki in dieser Frage eigentlich inkonsequent blieb und sich selbst widerspricht.
Die grundlegende Falschheit der Staatskapitalismusthese soll hier nicht ausführlich dargelegt werden, zumal dies schon an anderer Stelle geschehen ist (Spanidis 2018). Es genügt an dieser Stelle hervorzuheben, dass die These von Trotzkis Frau Sedowa, wonach die Sowjetunion ein kapitalistischer Staat geworden sei, den vollständigen Bruch mit dem Marxismus voraussetzt. Denn, wie auch ein großer Teil der Trotzkisten bis heute zugesteht, war die Sowjetunion eine Planwirtschaft auf Grundlage des Volkseigentums an den Produktionsmitteln, in der keine Ausbeuterklasse existierte und auch das Wertgesetz keine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Produktion spielte.
Fazit
Die Bürokratietheorie von Trotzki, die bis heute einen Kern des Trotzkismus ausmacht, ist keine plausible Analyse der Entwicklungen in der Sowjetunion, sondern eher ein Instrument der politischen Polemik gegen die UdSSR und andere sozialistische Länder. Ihre scheinbare Plausibilität beruht aber darauf, dass es in diesen Ländern natürlich tatsächlich Entwicklungen gab, die im Widerspruch zu den sozialistischen Grundlagen der dortigen Gesellschaften gerieten und historisch-materialistisch analysiert werden müssen. Dazu gehören sicherlich auch die Entwicklung von, im Vergleich zu kapitalistischen Gesellschaften sehr bescheidenen, aber dennoch realen Privilegien für bestimmte Schichten und Aufgabenbereiche; eine schrittweise Entfernung bestimmter (sicher nicht aller) Parteifunktionäre von den Problemen und Sorgen der Arbeiterklasse; aber auch unzureichende Formen der Mitbestimmung oder ein Erstarren der durchaus umfassend vorhandenen demokratischen Verfahren zu bloßen administrativen Abläufen. Trotzki entwickelte aber keine differenzierte und materialistische Analyse dieser Problemlagen, sondern erklärte die sozialistische Demokratie in der Sowjetunion kurzerhand für nichtexistent, ganz so wie es bürgerliche Antikommunisten in der Regel tun. Ebenso wenig findet sich bei ihm eine tragfähige Analyse der Ursachen dieser Probleme, sondern vielmehr eine eindimensionale und falsche Schuldzuschreibung, wonach eine bürokratische Clique unter Stalins Führung die Macht usurpiert hätte, einzig um ihre Privilegien zu schützen. Eine wissenschaftliche Analyse der Ursachen der Konterrevolution ist auf dieser Grundlage nicht möglich.
3.3 Die Strategie der Weltrevolution, der Sozialismus in einem Lande und die Außenpolitik der Sowjetunion
Eine der entscheidenden inhaltlichen Auseinandersetzungen zwischen Trotzki und Stalin, die bis heute einen Kernpunkt der trotzkistischen Kritik am sogenannten „Stalinismus“ ausmacht, ist die Frage der Weltrevolution. Trotzkisten behaupten bis heute, Stalin habe als Vertreter der Sowjetbürokratie die Weltrevolution aufgegeben und revolutionäre Bewegungen abgewürgt. Dies versuchen sie in der Regel mit dem Verweis auf die Kontroverse zwischen Trotzki und Stalin über die Frage der Weltrevolution zu belegen. Dabei vertrat Stalin in den 1920ern die Position, wonach der Aufbau des Sozialismus auch in einem Land möglich sei, während Trotzki darauf bestand, dass nur unter den Bedingungen einer siegreichen Weltrevolution der Sozialismus in der Sowjetunion überleben könne.
Trotzkis Behauptung, Stalin und die KPdSU hätten die Weltrevolution verraten, steht in engem Zusammenhang mit seiner These, wonach in der Sowjetunion die Arbeiterklasse nicht mehr die Macht ausübe und stattdessen eine Bürokratie unter Führung Stalins die Herrschaft übernommen, das heißt also der Arbeiterklassen entrissen habe. Das eine ergibt sich für Trotzki aus dem anderen: „Die Außenpolitik ist immer und überall eine Fortsetzung der Innenpolitik. denn sie wird von derselben herrschenden Klasse betrieben und verfolgt historisch dieselben Aufgaben. Die Entartung der herrschenden Schicht in der UdSSR musste mit einer entsprechenden Änderung in den Zielen und Methoden der Sowjetdiplomatie einhergehen. Bereits die „Theorie“ vom Sozialismus in einem Lande, die zum erstenmal im Herbst 1924 verkündet wurde, deutete auf den Wunsch hin, die Sowjetaußenpolitik vom Programm der internationalen Revolution zu befreien.“ (Trotzki 1936).
„Sozialismus in einem Land“ oder „permanente Revolution“?
In Wirklichkeit stammte die These von der Möglichkeit des Sozialismus in einem Lande gar nicht von Stalin, sondern wurde bereits von Lenin immer wieder formuliert. Lenin hatte schon 1915 geschrieben: „Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ist ein unabdingbares Gesetz des Kapitalismus. Hieraus folgt, daß der Sieg des Sozialismus ursprünglich in wenigen kapitalistischen Ländern oder sogar in einem einzeln genommenen Lande möglich ist.“ (Lenin 1915, S. 345). „Daraus die unvermeidliche Schlußfolgerung: Der Sozialismus kann nicht gleichzeitig in allen Ländern siegen. Er wird zuerst in einem oder einigen Ländern siegen, andere werden für eine gewisse Zeit bürgerlich oder vorbürgerlich bleiben.“ (Lenin 1916, S. 74). Ähnliche, sehr eindeutige Aussagen finden sich auch anderswo in Lenins Schriften (vgl. z.B. Lenin 1918, S. 252). Nachdem der Aufbau des Sozialismus begonnen hatte, bekräftigte er diese Position erneut: „In der Tat, die Verfügungsgewalt des Staates über alle großen Produktionsmittel, die Staatsmacht in den Händen des Proletariats, das Bündnis dieses Proletariats mit den vielen Millionen Klein- und Zwergbauern, die Sicherung der Führerstellung dieses Proletariats gegenüber der Bauernschaft usw. — ist das nicht alles (…), was notwendig ist, um die vollendete sozialistische Gesellschaft zu errichten? Das ist noch nicht die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft, aber es ist alles, was zu dieser Errichtung notwendig und hinreichend ist.“ (Lenin 1923, S. 454). Es handelte sich also nicht um einzelne, isolierte und verschieden interpretierbare Aussagen Lenins, sondern um einen sehr konsistenten Standpunkt. Wenn Trotzkisten später behaupteten, die These vom Sozialismus in einem Land sei eine Abkehr von Lenins Lehre gewesen, lässt sich das nur als Betrug bezeichnen.
Stalin entwickelte hierzu nämlich in Wirklichkeit überhaupt keine neue Position, sondern schloss sich lediglich dem Standpunkt Lenins an bzw. verteidigte diesen weiter nach Lenins Tod. Beide, Lenin und Stalin, betonten dabei sehr deutlich, dass die These vom Sozialismus in einem Land keineswegs im Widerspruch zur Weltrevolution stehe: „Aber die Macht der Bourgeoisie stürzen und die Macht des Proletariats in einem Lande aufrichten, heißt noch nicht, den vollen Sieg des Sozialismus zu sichern. Die Hauptaufgabe des Sozialismus – die Organisierung der sozialistischen Produktion – steht noch bevor. Kann man diese Aufgabe lösen, kann man den endgültigen Sieg des Sozialismus in einem Lande erreichen, ohne die gemeinsamen Anstrengungen der Proletarier mehrerer fortgeschrittener Länder? Nein, das kann man nicht. Zum Sturze der Bourgeoisie genügen die Anstrengungen eines Landes – davon zeugt die Geschichte unserer Revolution. Zum endgültigen Sieg des Sozialismus, zur Organisierung der sozialistischen Produktion genügen nicht die Anstrengungen eines Landes, zumal eines Bauernlandes wie Rußland, dazu sind die Anstrengungen der Proletarier mehrerer fortgeschrittener Länder notwendig.“ (Stalin 1924a, S. 95). Zwei Jahre später kritisierte Stalin seine eigene Formulierung als missverständlich und präzisierte sie: Es sei auch innerhalb eines Landes möglich, eine vollendete sozialistische Gesellschaft zu errichten. Solange allerdings die Bourgeoisie überall sonst an der Macht sei, bestehe immer noch die Gefahr einer Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion, weshalb man die Weltrevolution weiter anstreben müsse (Stalin 1926, S. 55f).
Trotzki hielt in seiner Streitschrift „Die permanente Revolution“ der These vom Sozialismus in einem Land seine Theorie der „permanenten Revolution“ entgegen: „Der Abschluß einer sozialistischen Revolution ist im nationalen Rahmen undenkbar. Eine grundlegende Ursache für die Krisis der bürgerlichen Gesellschaft besteht darin, daß die von dieser Gesellschaft geschaffenen Produktivkräfte sich mit dem Rahmen des nationalen Staates nicht vertragen. (…) Die sozialistische Revolution beginnt auf nationalem Boden, entwickelt sich international und wird vollendet in der Weltarena. Folglich wird die sozialistische Revolution in einem neuen, breiteren Sinne des Wortes zu einer permanenten Revolution: sie findet ihren Abschluß nicht vor dem endgültigen Siege der neuen Gesellschaft auf unserem ganzen Planeten“ (Trotzki 1929).
Aus diesem Text wird jedoch kaum klar, worin der inhaltliche Gegensatz zwischen Trotzkis und Stalins oder Lenins Position bestanden haben soll. Denn auch Lenin und Stalin vertraten ja den Standpunkt, dass die sozialistische Revolution auf der nationalstaatlichen Ebene lediglich beginnen könne, aber erst als Weltrevolution ihre Vollendung finden würde. Auch der folgende Satz steht in keinem inhaltlichen Gegensatz zu den Ausführungen Stalins, obwohl Trotzki ihn zweifellos als Angriff auf Stalin gemeint hatte: „Sich das Ziel zu stecken, eine national isolierte sozialistische Gesellschaft aufzubauen, bedeutet, trotz aller vorübergehenden Erfolge, die Produktivkräfte, sogar im Vergleich zum Kapitalismus, zurückzerren zu wollen“ (Trotzki 1929). In Wirklichkeit strebte auch Stalin nicht an, eine „national isolierte sozialistische Gesellschaft aufzubauen“. Trotzki beschränkte sich in seinen zahllosen Artikeln zumeist darauf, die Außenpolitik der Komintern als Verrat an der Weltrevolution zu brandmarken, während er es in der Regel vermied, konkret darauf einzugehen, was seine These der permanenten Revolution in der Praxis bedeuten würde.
Etwas konkreter war Trotzki in seiner älteren Schrift „Ergebnisse und Perspektiven“ von 1906 geworden. Darin heißt es: „Ohne die direkte staatliche Unterstützung durch das europäische Proletariat kann die russische Arbeiterklasse sich nicht an der Macht halten und ihre zeitweilige Herrschaft in eine dauernde sozialistische Diktatur umwandeln“. Und: „Ihren eigenen Kräften überlassen, wird die Arbeiterklasse Rußlands unvermeidlich in dem Augenblick von der Konterrevolution zerschlagen werden, in dem sich die Bauernschaft von ihr abwendet“. Zentral für Trotzkis Argumentation war also seine Einschätzung, dass ein stabiles Bündnis mit der Bauernschaft kaum möglich sein würde und diese sich früher oder später von der Revolution abwenden würde. Daraus folgerte er, die russische Arbeiterklasse müsse die Revolution nach Europa exportieren, gegebenenfalls auch durch Krieg gegen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn: „Wenn das russische Proletariat, das vorübergehend die Macht erlangt hat, nicht aus eigener Initiative die Revolution auf den Boden Europas überträgt, so wird die europäische feudalbourgeoise Reaktion es dazu zwingen. (…) Der Krieg gegen die Regierungen Wilhelm II. und Franz Josefs stellt für die revolutionäre Regierung Rußlands unter diesen Bedingungen einen Akt der Selbsterhaltung dar.“ (Trotzki 1906).
Aus Sicht der Mehrheit der Bolschewiki, die gerade unter größten Opfern die Staatsmacht erobert und verteidigt hatten, waren solche Vorstellungen des militärischen Revolutionsexports gefährliches Abenteurertum. Schließlich hatte das revolutionäre Russland nach dem Bürgerkrieg nicht einmal annähernd die Stärke, einen offensiven Krieg gegen auch nur eine der kapitalistischen Großmächte zu führen, geschweige denn gegen mehrere auf einmal. Die Konsequenz eines solchen militärischen Revolutionsexports, der höchstwahrscheinlich gescheitert wäre (so wie das revolutionäre Russland auch im Krieg gegen Polen 1920 unterlag), hätte das Ende des sozialistischen Aufbaus bedeuten können. Damit hätte sich die II. Internationale bestätigt gefühlt, dass die Revolution in Russland „zu früh“ kam. Nachdem die sozialistische Revolution in West- und Mitteleuropa, vor allem in Deutschland vorerst gescheitert war, bestand somit die Herausforderung darin, dem jungen sowjetischen Arbeiterstaat eine Atempause zu verschaffen, die dieser nutzen musste, um sich auf die kommenden Auseinandersetzungen ökonomisch, politisch und militärisch vorzubereiten. Diese Zielstellung drückte sich eben in der Parole vom „Sozialismus in einem Land“ aus.
Die Komintern und die Strategie der Weltrevolution in den 1920ern
Ein Aufgeben weitergehender revolutionärer Ziele auf internationaler Ebene ging damit keineswegs einher. Vielmehr wurde die Kommunistische Internationale in den nächsten Jahren zu einem machtvollen Instrument der kommunistischen Weltbewegung ausgebaut. Durch die tatkräftige finanzielle Unterstützung der Sowjetunion, die einen umfassenden Apparat von bezahlten Revolutionären ermöglichte, konnten sich in vielen Ländern innerhalb weniger Jahre aus kleinen unbedeutenden Gruppen starke kommunistische Parteien entwickeln (Firsov u.a. 2014, S. 38ff). Die Komintern verfolgte ständig die Entwicklungen in den verschiedenen Ländern und analysierte sie daraufhin, wie die Potenziale für eine erfolgreiche proletarische Revolution einzuschätzen waren. Nachdem die revolutionären Aufstände in Deutschland von 1918/19, 1920 und 1923 besiegt worden waren, wandte sich die Aufmerksamkeit der Komintern stärker auch anderen Ländern zu. Auch Stalin und andere sowjetische Führer beschäftigten sich intensiv mit diesen Fragen.
Die britische Regierung hatte die Sowjetunion 1924 diplomatisch anerkannt. 1926 kam es in England zu einem Aufschwung der Klassenkämpfe und einem Generalstreik, den die Sowjetunion stark unterstützte, auch mit materiellen Lieferungen an die streikenden Bergleute. 1927 brach die britische Regierung die diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion daher wieder ab (Lih 1995, S. 6). Das Politbüro der Bolschewiki ging in dieser Situation davon aus, dass in England eine revolutionäre Situation heranreifte. Stalin setzte sich dafür ein, dass mehr Geld für die Minenarbeiter gesammelt werde und dass zur Unterstützung des Streiks ein Embargo auf britische Kohle erlassen würde, wie es die britischen Kommunisten gefordert hatten. Und während er einen vollständigen Bruch mit den reformistischen Gewerkschaften aufgrund der mangelnden Verankerung der für britischen Kommunisten für taktisch unklug hielt, schlug er vor, die Gewerkschaftsführer wegen ihrer mangelnden Beschäftigung mit dem Streik zu attackieren. Alles in allem zeigen die Briefe zwischen Stalin und Molotow ein starkes Interesse der sowjetischen Führung an der Situation in England und eine tief empfundene Hoffnung auf eine erfolgreiche Revolution (ebenda, S. 28ff).
Die andere brennende Frage in der zweiten Hälfte der 1920er war die Revolution in China. Die Komintern ging Anfang 1926 von einer antiimperialistischen Umwälzung in China aus, in der die bürgerliche Kuomintang zunächst die Hauptrolle spielen würde, aber von den Kommunisten und der Arbeiterklasse unterstützt werden sollte. Stalins Meinung zufolge sollte die Kuomintang eine gründliche Agrarreform zugunsten der Bauern durchführen, um damit ihre soziale Basis und auch ihren antiimperialistischen Charakter zu stärken. Nachdem die Kuomintang sich gegen die Kommunisten wandte, änderte sich die Einschätzung. Stalin verglich die Situation der chinesischen Genossen nun mit der Lage nach der gescheiterten russischen Revolution von 1905 und vermutet, dass man in China nun einen ähnlich langen Zeitraum warten müsse wie die Bolschewiki in Russland (bis 1917, also zwölf Jahre), bis ein neuer revolutionärer Aufschwung stattfinden würde. Er warnte die KP Chinas nun vor einer Welle harter Repressionen und zog die Schlussfolgerung, dass die Komintern die chinesische KP besser durch marxistische Literatur und fähige Berater unterstützen solle, um den Kampf für die chinesische Revolution voranzubringen: „Wir sollten nach China regulär nicht Leute schicken, die wir nicht brauchen, sondern kompetente Leute“ (ebenda, S. 30ff).
Der bürgerliche Historiker Lars T. Lih schlussfolgert aus seiner Analyse der Briefwechsel zwischen Stalin und Molotow: „Die Briefe widerlegen die von Trotzki herkommende Interpretation des ‚Sozialismus in einem Land‘ als isolationistische Ablehnung der Revolution in anderen Ländern. Sicherlich, Stalin ignorierte nie die Interessen des sowjetischen Staates und war oft vorsichtig bis pessimistisch über die Aussichten der sofortigen Revolution. Die Briefe zeigen aber, dass er auch fähig zur Hoffnung und zum Enthusiasmus war, wenn die Revolution voranging und dass er bereit war, den Worten Taten folgen zu lassen. Die Briefe dokumentieren auch seine nicht nachlassende Feindschaft und Misstrauen gegen die kapitalistische Welt, selbst wenn er gezwungen war, mit ihr zu verhandeln. Er war wachsam, dass die berufsmäßigen Außenpolitiker nicht der Krankheit der rechten Degeneration verfallen und die Fähigkeit verlieren, den revolutionären Aspekt der Diplomatie zu erkennen. Alles in allem erscheint Stalin in den Briefen mit intakter revolutionärer Glaubwürdigkeit. Stalin sah also Staatsinteressen und revolutionäre Interessen nicht als ‚entweder-oder‘“. (Lih u.a. 1995, S. 36).
Die Politik der Volks- und Einheitsfront
In den 1930ern konzentrierten die Komintern und die Außenpolitik der UdSSR sich zunehmend darauf, den aggressiven Vormarsch des Faschismus, vor allem also des Deutschen Reiches und des Japanischen Kaiserreiches, aufzuhalten. Auch hier bestand aus Sicht der sowjetischen und der Komintern-Führer eine enge Überschneidung sowjetischer Staatsinteressen, da man die Sowjetunion als wahrscheinliches Ziel eines deutschen oder japanischen Angriffs sah, mit den revolutionären Interessen, da der Faschismus die Handlungsfreiheit der Kommunisten und der Arbeiterbewegung massiv einschränkte. Mit der Volksfrontpolitik, die auf dem VII. Weltkongress der Komintern 1935 beschlossen wurde, kehrten die kommunistischen Parteien sich ab von der bisherigen Taktik der revolutionären Offensive, bei der man auch die sozialdemokratischen Parteien als Stütze des Kapitalismus angriff. Mit der Politik der „Volks- und Einheitsfront“ sollten die Kommunisten nun mit den sozialdemokratischen und anderen nichtfaschistischen bürgerlichen Parteien gegen den Faschismus zusammenarbeiten. Als Abkehr von revolutionären Zielen war jedoch auch das nicht gemeint. Der Generalsekretär der Komintern Georgi Dimitroff war diesbezüglich in seinem für die kommunistischen Parteien richtungsweisenden Referat sehr deutlich. Über die Volksfrontregierungen hieß es: „Die endgültige Rettung kann diese Regierung nicht bringen. Sie ist nicht imstande, die Klassenherrschaft der Ausbeuter zu stürzen und kann daher auch die Gefahr der faschistischen Konterrevolution nicht endgültig beseitigen. Folglich muß man sich zur sozialistischen Revolution vorbereiten“. Dimitroff zufolge sei es zwar möglich, dass aus einer Einheitsfrontregierung eine Übergangsform hin zur proletarischen Revolution entstehe, jedoch sei es nicht möglich, in einem „friedlichen parlamentarischen Spaziergang“ zur Diktatur des Proletariats überzugehen (Dimitroff 1935). Ob die Ausführungen Dimitroffs zur revolutionären Strategie und Taktik richtig waren, ist hier nicht Gegenstand der Betrachtung. In der Tat können wir aus heutiger Sicht, mit den Erfahrungen der folgenden Jahrzehnte im Hintergrund, feststellen, dass manches an diesem Referat problematisch war (Spanidis 2017). Entscheidend ist hier nur, dass es sich für die kommunistischen Führer damals um eine taktische Konzeption zur Bekämpfung des Faschismus und zur Förderung der Interessen der Weltrevolution handelte, nicht um eine Abkehr davon. Dies zeigt sich auch daran, dass die Komintern weiterhin revolutionäre Aufstände organisierte, wo sie diesen eine Erfolgsperspektive zugestand. So in Brasilien im November 1935, wo die Komintern den Versuch einer revolutionären Machtübernahme der Brasilianischen Kommunistischen Partei unter ihrem Generalsekretär Luis Carlos Prestes organisatorisch, technisch und finanziell unterstützte. Sie schickte ihren Agenten Pavel Stuchevsky nach Brasilien, um den Erfolg des Aufstands zu sichern. Er scheiterte – zumindest auch – wegen des Verrat von Johann de Graaf, einem Mitarbeiter des sowjetischen Militärgeheimdienstes, der aber in Wirklichkeit für den britischen Geheimdienst MI6 arbeitete und später nach Großbritannien überlief (Firsov u.a. 2014, S. 28f).
Von Trotzki hingegen war keine ausgewogene Analyse des VII. Weltkongresses und der Volksfrontpolitik zu erwarten. Er sah in der Volksfrontpolitik ebenso wie in der davor verfolgten Komintern-Linie der revolutionären Offensive und des Kampfes gegen die Sozialdemokratie einen Verrat an der Revolution. So warf er der neu gewählten Volksfrontregierung in Spanien vor, ihr einziger Zweck bestehe darin, die Revolution zu verhindern: „Indem sie die soziale Revolution aufhalten, verdammen sie die Arbeiter und Bauern dazu, zehnmal mehr ihres eigenen Blutes im Bürgerkrieg zu vergießen. Und als Krönung erwarten diese Herren, die Arbeiter nach dem Sieg wieder zu entwaffnen und zwingen sie, die heiligen Gesetze des Privateigentums zu respektieren. Das ist das wahre Wesen der Politik der Volksfront“ (Trotsky 1936). Trotzki erkennt keine objektiven Zwangslagen an, keine taktischen Kompromisse im Kampf gegen die faschistische Bedrohung, für ihn gibt es auf Seiten der Komintern nicht einmal mehr Fehleinschätzungen, die von ehrlichen Revolutionären vorgenommen werden – stattdessen sieht er überall nur noch Verrat und ein einziges Ziel am Werk, nämlich die Verhinderung der Revolution durch die Komintern und Stalin.
Vom Nichtangriffsvertrag mit Deutschland 1939 bis zum faschistischen Überfall auf die Sowjetunion 1941
Nachdem Frankreich und Großbritannien die sowjetischen Versuche zum Abschluss eines Verteidigungsbündnisses gegen Deutschland jahrelang blockiert und torpediert hatten, entschloss sich die Sowjetunion im August 1939 dazu, einen Nichtangriffsvertrag mit Deutschland zu schließen, um sich auf diese Weise gegen eine Invasion abzusichern. Dieser Nichtangriffsvertrag, der in der antikommunistischen Geschichtsschreibung als „Hitler-Stalin-Pakt“ behandelt wird, die Ursachen für sein Zustandekommen und die Überlegungen dahinter können hier nicht behandelt werden, sie müssten Gegenstand eines eigenen Artikels sein. An dieser Stelle ist wichtig, dass damit eine vorübergehende Wende in der sowjetischen Außenpolitik und der Haltung der Komintern eingeleitet wurde. In einem Gespräch mit Schdanow, Molotow und Dimitroff am 7. September vertrat Stalin die Einschätzung, dass es sich um einen zwischenimperialistischen Krieg handle, der den Kapitalismus insgesamt schwäche. Zwar helfe der Nichtangriffsvertrag jetzt Deutschland, dafür werde sich die UdSSR beim nächsten Mal auf die andere Seite stellen. Die Unterscheidung der kapitalistischen Länder in demokratische und faschistische habe jetzt ihren Sinn verloren, ebenso sei es nun falsch geworden, die bürgerliche Demokratie zu verteidigen. Es gehe nicht mehr darum, mit der Volksfrontpolitik die Lage der Arbeiter zu verbessern, sondern durch die Schwächung des Kapitalismus ergebe sich die Situation, die Sklaverei des Kapitalismus überhaupt abzuwerfen (Dimitrov 2003, S. 115f). Stalin dachte hier offenbar an den Ersten Weltkrieg, der die Oktoberrevolution ermöglicht hatte und hoffte darauf, dass ein neuer Krieg zwischen den Imperialisten zu einer revolutionären Situation führen könne.
Während die Komintern anfangs beide Seiten des Krieges als Parteien eines zwischenimperialistischen Krieges verurteilte, verschob sich im Verlauf des Jahres 1940 der Fokus hin zur Agitation gegen die deutsche Aggression. Im Gespräch mit dem sowjetischen Außenminister Molotow vom 25. November 1940 sprach Dimitroff über das Vorgehen der Komintern angesichts der komplizierten Situation. Die kommunistischen Parteien betrieben eine Propaganda gegen die deutschen Besatzungstruppen und wollten diese weiter intensivieren. Dimitroff fragte nun Molotow, ob das nicht mit der sowjetischen Politik in Widerspruch geraten würde. Molotows Antwort: „Das ist natürlich das, was wir tun müssen. Wir wären keine Kommunisten, wenn wir nicht einen solchen Kurs verfolgen würden. Nur muss es leise geschehen.“ (ebenda, S. 136). Nach dem Überfall der Achsenmächte auf Jugoslawien wurden die bulgarischen Kommunisten von der Komintern angewiesen, die Beteiligung Bulgariens an dem Angriffskrieg zu verurteilen und eine Kampagne gegen den deutschen Imperialismus zu entwickeln. Nach dem Überfall und der Besatzung Griechenlands durch Deutschland, Italien und Bulgarien gab die Komintern die Parole heraus: „Der Krieg des griechischen und jugoslawischen Volkes gegen die imperialistische Aggression ist ein gerechter Krieg“ (ebenda, S. 155). Im Februar 1941 organisierte die Komintern eine Konferenz mit der französischen KP, in der es um die Organisierung des antifaschistischen Widerstands ging. Es wurde weiterhin auf die antifaschistische Volksfront unter Beteiligung der KP gesetzt, die ihr Feuer vor allem auf die faschistischen Kollaborateure um Pierre Laval und Marcel Déat in Paris konzentrieren und auch, aber erst in zweiter Linie, gegen die Regierung von Pétain in Vichy kämpfen sollte (ebenda, S. 147).
Wie kommentierte Trotzki den Nichtangriffsvertrag? Triumphierend verweist er darauf, dass er „seit 1933 immer wieder in der Weltpresse erklärt habe, dass das grundlegende Ziel von Stalins Außenpolitik sei, eine Übereinkunft mit Hitler zu erreichen“. Dass diese Behauptung völlig absurd war, angesichts der Tatsache, dass die Sowjetunion seit 1933 in ihrer Außenpolitik das exakte Gegenteil betrieben hatte, musste auch den Zeitgenossen auffallen. Der „deutsch-russische Pakt“ sei „eine Militärallianz im vollen Sinne des Wortes“. Stalin sei nun der „Quartiermeister“ Hitlers (Trotzki 1939a). Tatsächlich bedeutete der Vertrag jedoch, wie wir gesehen haben, weder dass die Sowjetunion Deutschland als ihren Verbündeten betrachtete, noch dass sie sich Illusionen über dessen imperialistischen und reaktionären Charakter machte, noch dass die Politik des antifaschistischen Widerstands eingestellt wurde. Eine „Militärallianz“ war er schon gar nicht. Solche und ähnliche Behauptungen bekommen wir oft zu hören, nicht nur von Trotzkisten, sondern auch von bürgerlichen Historikern (z.B. Firsov u.a. 2014, S. 248). Sie entsprechen jedoch nicht den Tatsachen, sondern stellen eine Verfälschung der tatsächlichen Politik der Sowjetunion und der Komintern dar. Diese Verfälschung dient dem Ziel, den sowjetischen Sozialismus im Sinne der unwissenschaftlichen Totalitarismusdoktrin in die Nähe des deutschen Faschismus zu rücken.
Der antifaschistische Krieg und die Auflösung der Komintern
Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 waren alle Anstrengungen der kommunistischen Weltbewegung und der sowjetischen Außenpolitik darauf konzentriert, sämtliche verfügbaren Kräfte gegen den Faschismus zu richten, von dem nun eine unmittelbar existenzbedrohende Gefahr für die Sowjetunion ausging. Die Komintern wies in dieser Phase auch die kommunistischen Parteien in den westlichen „demokratischen“ kapitalistischen Ländern an, ihre Regierungen im Krieg gegen die Achsenmächte zu unterstützen. Das bedeutete natürlich auch, dass sie während der Dauer des Krieges keine gewaltsamen Aktionen gegen den Staat unternehmen sollten, um nicht die antifaschistischen Kriegsanstrengungen zu untergraben. 1943 wurde die Komintern dann aufgelöst, nachdem entsprechende Überlegungen schon seit 1941 angestellt wurden.
Oft wird behauptet, der ausschlaggebende Grund für die Auflösung der Komintern habe darin gelegen, dass die Sowjetunion ihren kapitalistischen Verbündeten einen Gefallen tun wollte und ihnen signalisieren wollte, dass man keine Gefahr für die kapitalistische Ordnung mehr darstellte. Ein Blick auf die historischen Quellen kann auch diese Behauptung jedoch nicht bestätigen. In der offiziellen Erklärung zur Auflösung der Komintern lautet die Begründung vielmehr, dass die Bedingungen in den verschiedenen Ländern zu unterschiedlich seien, um den Kampf überall mit einer gemeinsamen Strategie und einem einheitlichen leitenden Zentrum zu führen (Präsidium des EKKI 1943). Dimitroffs Tagebuch belegt, dass dies auch den internen Diskussionen entsprach. So argumentierte Stalin schon bei einem Gespräch mit Dimitroff am 20. April 1941, dass die kommunistischen Parteien unabhängig werden müssten, um sich besser im Volk verankern zu können. Sie sollten ihre eigenen Programme haben und von den konkreten Problemen in ihrem Land ableiten, statt „über die Schulter nach Moskau zu schielen“. Am darauffolgenden Tag führte Stalin dieselbe Diskussion mit den Führern der italienischen und der französischen KP Palmiro Togliatti und Maurice Thorez, die beide derselben Ansicht waren (Dimitrov 2003, S. 155f). Auch bei der Auflösung der Komintern im Mai 1943 wurden entsprechende Diskussionen zwischen Stalin und den Komintern-Führern geführt. Neben der bereits genannten Argumentation, dass es nicht möglich sei, den Kampf in allen Ländern von einem einheitlichen Zentrum aus zu führen, sagte Stalin nun auch, dass die Auflösung der KI zudem den kommunistischen Parteien die Verankerung in der Arbeiterklasse erleichtern würde, weil sie es dem Klassengegner nicht mehr möglich mache, die KPen als Agenten einer ausländischen Macht darzustellen (ebenda, S. 276).
Diese Quelle widerlegt mehrere antisowjetische Mythen auf einmal: Erstens fanden diese Gespräche bereits vor dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion statt (der am 22. Juni desselben Jahres begann), weshalb die Frage der Zugeständnisse an die westlichen Alliierten keine Rolle gespielt haben dürfte. Zweitens lautete auch die interne Begründung für die Komintern-Auflösung keineswegs, dass man damit die kapitalistischen Länder von der eigenen Ungefährlichkeit überzeugen wollte, sondern im Gegenteil, dass die Unabhängigkeit der KPen zu stärken sei, damit diese besser ihre revolutionären Aufgaben erfüllen könnten. Drittens betrachteten Stalin und die sowjetische Parteiführung die kommunistischen Parteien der anderen Länder keineswegs als bloße Instrumente ihrer Außenpolitik – auch das eine häufige Behauptung – sondern wünschten sich im Gegenteil eine größere Unabhängigkeit dieser Parteien von Moskau. Aus heutiger Sicht war die Auflösung der Komintern trotzdem ein großer Fehler, da sie die nationalen Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern überbetonte und die kommunistischen Parteien der Fähigkeit beraubte, ihre Strategie gegen den Imperialismus gemeinsam zu entwickeln. Als Beleg für einen angeblichen Verrat der Sowjets an der Weltrevolution taugt diese Maßnahme jedoch nicht.
Nach 1945: Die Konzeption der Volksdemokratien
Nach Kriegsende waren in den meisten Ländern die kommunistischen Parteien enorm gestärkt. Dies lag an ihrer Vorreiterrolle im antifaschistischen Widerstand, der allgemeinen Diskreditierung des kapitalistischen Systems, das den Faschismus hervorgebracht hatte und schließlich auch der Tatsache, dass die Sowjetunion die Hauptrolle beim Sieg über Nazideutschland gespielt hatte. Kommunistische Parteien, die nun innerhalb weniger Jahre einen gewaltigen Masseneinfluss errungen hatten, wie die italienische KP (PCI), die französische KP (PCF) und die KP Griechenlands (KKE), beteiligten sich jetzt an Koalitionsregierungen der „Nationalen Einheit“. Es handelte sich dabei um Regierungen, die als Fortführung der Volksfrontpolitik verstanden wurden und bei denen Kommunisten auf dem Boden des Kapitalismus an der Verwaltung und dem Wiederaufbau der bürgerlichen Ordnung beteiligt waren. Zweifellos ist aus heutiger Frage stark infrage zu stellen, ob diese taktische Entscheidung richtig war. Sie beruhte jedoch auf der Hoffnung, den Aufbruch der Nachkriegszeit und die radikal verschobenen Kräfteverhältnisse dafür nutzen zu können, einen relativ leichten und gewaltlosen Weg zum Sozialismus gehen zu können. Dies drückte sich im Konzept der „Volksdemokratien“ oder beispielsweise in Deutschland in der Konzeption der „antifaschistisch-demokratischen Umwälzung“ aus, die als Zwischenetappe im Kampf für den Sozialismus verstanden wurde.
So formulierte die SED, damals noch in der Sowjetischen Besatzungszone, in ihren „Grundsätzen und Zielen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ von 1946: „Die gegenwärtige besondere Lage in Deutschland, die mit der Zerbrechung des reaktionären staatlichen Gewaltapparates und dem Aufbau eines demokratischen Staates auf neuer wirtschaftlicher Grundlage entstanden ist, schließt die Möglichkeit ein, die reaktionären Kräfte daran zu hindern, mit den Mitteln der Gewalt und des Bürgerkrieges der endgültigen Befreiung der Arbeiterklasse in den Weg zu treten.“ (zit. n. Doernberg 1964, S. 81). Es wurde darin also erstens das Ziel der sozialistischen Revolution hervorgehoben und zweitens argumentiert, dass unter den besonderen Bedingungen von 1946, wo der imperialistische deutsche Staatsapparat gewaltsam durch ausländische Armeen zerschlagen worden war, der Übergang zum Sozialismus ohne Bürgerkrieg möglich sei. Dafür wurde die antifaschistisch-demokratische Umwälzung als erste Etappe der sozialistischen Revolution gesehen und damit also gleichzeitig festgehalten, dass der Sozialismus das Ziel des ganzen Prozesses bleibe. Die in der DDR veröffentlichte „Kurze Geschichte der DDR“ schreibt dazu: „Gestützt auf die neue Qualität, die die Staatsmacht durch die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik erhalten hatte, konnte nunmehr der Prozeß des Hinüberwachsens der demokratischen in die sozialistische Etappe der Revolution in ein neues Stadium treten. Die Entwicklung der revolutionär-demokratischen Arbeiter-und-Bauern-Macht zu einer Staatsmacht, die voll und ganz die Funktionen der Diktatur des Proletariats ausübt, vollzog sich im Osten Deutschlands nicht durch einen einmaligen Akt, sondern war die Folge allmählicher qualitativer Veränderungen auf friedlichem Wege.“ (Doernberg 1964, S. 154). Der Aufbau des Sozialismus wurde auf der 2. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 als offizielle Zielstellung angenommen. Die These, wonach sich 1945 erst einmal der Aufbau von antifaschistischen und volksdemokratischen Staaten als Aufgabe stellte, war somit keineswegs als Aufgabe der sozialistischen Revolution gemeint, sondern vielmehr als Weg dahin.
Stalin vertrat im Dezember 1948 die Position, dass die Volksdemokratie keine Alternative zur Diktatur des Proletariats sei, sondern eine Form derselben. Dass man die Diktatur des Proletariats brauche, um den Sozialismus zu erreichen, sei ein Axiom (d.h. eine Grundannahme, die keines Beweises bedarf). Die Volksdemokratie könne zwar auf bestimmte Formen der Repression gegen die ehemaligen herrschenden Klassen verzichten, da in ihnen die Arbeiterklasse mithilfe der Roten Armee an die Macht gekommen sei, jedoch könne von einem Verschwinden der Diktatur des Proletariats erst dann die Rede sein, wenn die Ausbeuterklassen ganz verschwunden seien. Gut zwei Jahre zuvor hatte Stalin bei einem Treffen von Mitgliedern des Politbüros noch die Einschätzung vertreten, in Bulgarien wäre aufgrund der spezifischen Situation des Landes ein Übergang zum Sozialismus auch ohne Diktatur des Proletariats möglich. Diese Einschätzung verwarf er spätestens jetzt wieder (Dimitrov 2003, S. 414; 451).
Es zeigte sich, dass die Konzeption der Volksdemokratie nur in den Ländern, die von der Roten Armee befreit worden waren oder sich aus eigener Kraft befreit hatten, einen Weg in Richtung Sozialismus öffnen konnte. Trotzdem blieb die Konzeption einer solchen Übergangsphase zwischen Kapitalismus und Sozialismus weiterhin einflussreich und begünstigte die Stärkung revisionistischer Positionen in der kommunistischen Weltbewegung. Vor allem zeigte sich dies nach dem 20. Parteitag der KPdSU 1956, auf dem ein freundschaftliches Verhältnis zum US-Imperialismus, sowie die Möglichkeit des friedlichen Übergangs zum Sozialismus in den Beschlüssen festgehalten wurden. In den Nachkriegsjahren waren diese Orientierungen jedoch nie als grundsätzliche Abkehr vom Ziel der Weltrevolution verstanden worden.
Die Frage der Revolution in den Jahren vor Stalins Tod
Die Sowjetunion war in diesen Jahren ein zerstörtes, ausgeblutetes Land. Es ist verständlich, dass sie auch in diesen Jahren die Priorität darauf legte, sich vor einer erneuten Invasion zu schützen. Entsprechende Pläne wurden in den westlichen Hauptstädten bereits vorbereitet (z.B. die Operation Unthinkable des britischen Generalsstabs, mit der ein neuer Überfall auf die Sowjetunion geplant wurde). Die Schaffung eines neuen Bündnissystems sozialistischer Staaten in Osteuropa diente nicht nur der Verbreitung des sozialistischen Gesellschaftssystems, sondern auch der besseren gemeinsamen Verteidigung des sozialistischen Lagers.
Das bedeutet aber nicht, dass Stalin sich am Ende seines Lebens von seinen revolutionären Überzeugungen gelöst hätte, um nur noch ganz gewöhnliche Großmachtpolitik zu machen, oder sich allein auf die Verteidigung der UdSSR zu konzentrieren. Vielmehr wurden auch jetzt noch die Staatsinteressen der Sowjetunion und die Frage der Weltrevolution weiterhin in einem engen Zusammenhang gesehen. Das zeigt sich vor allem in Stalins Schrift „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ von 1952. Es handelt sich dabei um die wichtigste theoretische Schrift Stalins aus der Nachkriegszeit. Stalin intervenierte damit in stattfindende Diskussionen innerhalb der Sowjetunion und grenzte seine Position gegen die Auffassungen bestimmter sowjetischer Ökonomen ab. Wir können also davon ausgehen, dass Stalin hier das schrieb, was er auch wirklich dachte. Stalin wiederholte darin seine frühere Auffassung bezüglich der Notwendigkeit der revolutionären Machtübernahme durch das Proletariat: „günstige Bedingungen für die Machtergreifung darf man nicht vorübergehen lassen, das Proletariat muss die Macht ergreifen“ (Stalin 1952, S. 14). Vor allem kritisiert er aber auch die unverkennbare Tendenz der Friedensbewegung, den Kampf für den Frieden vom Kampf um den Sozialismus abzutrennen. Die Friedensbewegung setze „sich nicht das Ziel, den Kapitalismus zu stürzen und den Sozialismus zu errichten – sie beschränkt sich auf die demokratischen Ziele des Kampfes für die Erhaltung des Friedens. In dieser Beziehung unterscheidet sich die gegenwärtige Bewegung für die Erhaltung des Friedens von der Bewegung während des ersten Weltkrieges für die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg, da diese Bewegung weiterging und sozialistische Ziele verfolgte.“ (ebenda, S. 37). Die Zielsetzung dieser Friedensbewegung in den Nachkriegsjahren kritisiert er als unzureichend: „Aber dennoch genügt das nicht, um die Unvermeidlichkeit von Kriegen zwischen den kapitalistischen Ländern überhaupt zu beseitigen. Es genügt nicht, da bei allen diesen Erfolgen der Friedensbewegung der Imperialismus dennoch erhalten bleibt, bestehen bleibt und folglich auch die Unvermeidlichkeit der Kriege bestehen bleibt. Um die Unvermeidlichkeit der Kriege zu beseitigen, muss der Imperialismus vernichtet werden.“ (ebenda, S. 37f). Stalin argumentierte hier also gegen die sich breit machende Tendenz, dem Imperialismus eine grundsätzliche Friedensfähigkeit zu attestieren und betonte demgegenüber die marxistische Position, dass nur die sozialistische Revolution dem Krieg ein Ende machen könne.
Er befasst sich in derselben Schrift auch mit der Frage, wie die sozialistische Wirtschaft in der Sowjetunion weiterentwickelt werden sollte. Gegen den Vorschlag zweier Ökonomen, die staatlichen Maschinen-Traktoren-Stationen aufzulösen und den Kollektivwirtschaften auf dem Land zu verkaufen, führte er grundsätzliche theoretische Argumente ins Feld. Eine solche Maßnahme würde nicht nur den Kollektivwirtschaften eine ungerechtfertigte Sonderstellung einräumen, sondern wäre auch ein Rückschritt weg von der Entwicklung zum Kommunismus: „Daraus würde sich zweitens eine Erweiterung des Wirkungsbereichs der Warenzirkulation ergeben, denn ungeheure Mengen von Produktionsinstrumenten der Landwirtschaft würden in die Bahn der Warenzirkulation geraten. (…) Kann die Erweiterung des Wirkungsbereichs der Warenzirkulation unsere Entwicklung zum Kommunismus fördern? Wäre es nicht richtiger zu sagen, dass sie unsere Entwicklung zum Kommunismus nur hemmen kann?“ (ebenda, S. 92f). Stattdessen argumentiert er dafür, dass die Beziehungen zwischen dem Staat und den Kollektivwirtschaften zukünftig zunehmend auf das Geld verzichten und stattdessen direkt Produkte austauschen sollten: „Ein solches System, das den Wirkungsbereich der Warenzirkulation einengt, wird den Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus erleichtern“ (ebenda, S. 95).
Wir sehen also, dass Stalin auch am Ende seines Lebens die historische Aufgabe der Sowjetunion weiterhin darin sah, die nächsten Schritte zum Kommunismus zu gehen. In ähnlicher Weise sah er die Aufgabe der kommunistischen Weltbewegung weiterhin darin, den Sozialismus in immer mehr Ländern zu erkämpfen. Entscheidend, um das Verhältnis zwischen kurzfristigen taktischen Entscheidungen und langfristigen Zielen richtig zu verstehen, ist wohl, dass die sowjetische Führung nach 1945 und auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der 1920er und 1930er Jahre davon ausging, dass der weltrevolutionäre Prozess sich eben nicht innerhalb kurzer Zeit, als weltrevolutionäre Welle vollziehen würde, sondern in einem langfristigen Kampf zwischen den beiden Systemen, bei dem die kommunistische Weltbewegung auch zu verschiedenen Kompromissen und Manövern bereit sein müsse, aber das revolutionäre Ziel nicht aus den Augen verlieren sollte.
Aufschwung der revolutionären Kämpfe auf der Welt in der Nachkriegszeit
Tatsächlich verliefen die Klassenkämpfe der unmittelbaren Nachkriegszeit in sehr unterschiedlichen Bahnen. Während die französische und italienische KP sich dagegen entschieden, ihre neu gewonnene Stärke und die Schwäche des bürgerlichen Staates für den Versuch einer revolutionären Machtübernahme zu nutzen, begann in der britischen Kolonie Malaya die kommunistische Partei einen kraftvollen Guerillakrieg gegen die britische Kolonialmacht, ebenso wie die Kommunistische Partei Vietnams gegen Frankreich. Die Kommunistische Partei Chinas setzte den revolutionären Bürgerkrieg gegen die Kuomintang-Regierung fort bis zum Sieg und der Gründung der Volksrepublik China im Jahre 1949. Die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) entschied sich 1946 ebenfalls wieder für den bewaffneten Kampf gegen das von Großbritannien unterstützte reaktionäre Regime.
Der Fall Griechenland ist besonders interessant und in der Diskussion um die weltrevolutionäre Strategie wenig beachtet worden: Die KKE hatte seit den 1930ern die These vertreten, dass Griechenland für den Sozialismus noch nicht reif war und daher zuerst eine bürgerlich-demokratische Revolution, allerdings unter Führung der Arbeiterklasse und durch den bewaffneten Aufstand, durchzuführen wäre. Auch während der längsten Zeit des Bürgerkrieges 1946-49 wurde der Kampf unter der Parole der volksdemokratischen Revolution geführt. In den letzten Monaten des Bürgerkrieges im Jahre 1949 änderte die KKE jedoch ihre strategische Orientierung. Im Referat des Generalsekretärs Nikos Zachariadis heißt es: „Daher werden wir heute, als Ergebnis des Sieges der Volksrevolution in Griechenland, kein gesondertes Entwicklungsstadium für die Vervollständigung der bürgerlich-demokratischen Transformation des Landes haben, sondern, in ununterbrochener Kontinuität, einen mehr oder weniger schnellen Übergang zur sozialistischen Revolution.“ (zitiert nach: Skolarikos 2016, S. 127). Damit wurde der bewaffnete Kampf unter die Parole des Kampfes für den Sozialismus gestellt. Der Griechische Bürgerkrieg wird aber auch oft angeführt, um den angeblichen Verrat der Sowjetunion an der Weltrevolution anzuführen, da die sowjetische Führung (die in der Regel auf Stalin reduziert wird), den griechischen Genossen die Unterstützung versagt hätte. Es ist zwar richtig, dass die Sowjetunion nicht unmittelbar in den Krieg in Griechenland intervenierte – der Grund dafür liegt auf der Hand, da die UdSSR nach Kriegsende enorme Zerstörungen und Verluste an Menschenleben zu beklagen hatte und vorerst keinen neuen Krieg mit den USA riskieren wollte. Eine Unterstützung der griechischen Partisanen fand dennoch in Absprache mit der sowjetischen Führung über die Nachbarländer Bulgarien, Jugoslawien und Albanien statt. Stalins Haltung dazu wird aus einem Gespräch mit bulgarischen und jugoslawischen Genossen vom Februar 1948 klar: Stalin äußert Zweifel daran, dass eine Revolution in Griechenland günstige Aussichten habe, daher wäre es vielleicht besser, den bewaffneten Kampf auf einen besseren Zeitpunkt zu verschieben. Im weiteren Gespräch rät er dann aber dazu, erst mal den weiteren Verlauf des Kampfes abzuwarten und vorerst die Kommunisten in Griechenland weiter zu unterstützen. Er vergleicht den griechischen Fall mit den Erfahrungen aus China, wo die Komintern schließlich ebenfalls einen Erfolg der Kommunisten für unwahrscheinlich gehalten habe. Dort hätten die chinesischen Genossen aber Recht gehabt und die Komintern bzw. die Sowjetunion Unrecht, da es in Wirklichkeit sehr günstige Voraussetzungen für einen Sieg gebe. Vielleicht wäre es ja jetzt in Griechenland auch so, aber man müsse zumindest sicher sein, was man tut. Auf die Frage des bulgarischen Genossen Trajtscho Kostow, ob denn die USA einen Sieg der Revolution in Griechenland erlauben würden, antwortet Stalin: „Sie werden nicht gefragt. Wenn genug Kräfte vorhanden sind um zu gewinnen, dann sollte der Kampf fortgesetzt werden.“ (Dimitrov 2003, S. 441ff).
Fazit: Der Vorwurf des „Verrats an der Weltrevolution“ im Lichte der historischen Tatsachen
Insgesamt können wir festhalten, dass wir in der Periode nach 1945 zwar einerseits vom Versuch der Fortsetzung der Volksfrontpolitik, also der Bündnisse mit bürgerlichen Kräften, andrerseits aber auch weltweit zwar von einem Aufschwung von Klassenkämpfen und Revolutionen gekennzeichnet war und nicht allgemein von einer Aufgabe revolutionärer Ambitionen.
Wir sehen also, dass die vom Trotzkismus bis heute vertretene These, wonach die kommunistische Weltbewegung unter Stalins Führung seit Mitte der 20er das Ziel der Weltrevolution aufgegeben hatte, jeder Grundlage entbehrt. Die Faktenlage zeigt ein völlig anderes Bild: Mit der Gründung der Sowjetunion und ihrem Aufstieg zur Weltmacht entstand für die kommunistische Bewegung jeweils eine vollkommen neue Situation. Es gab keine Erfahrungen oder Anweisungen bei den Klassikern des Marxismus-Leninismus, auf die man zurückgreifen konnte, um die daraus erwachsenden Herausforderungen zu bewältigen. Die Führung der Bolschewiki versuchte diese Herausforderungen zu lösen, indem sie die Staatsinteressen des revolutionären Staates und den Kampf für die Verbreitung der Revolution als zusammengehörig dachte. Und immer da, wo die unmittelbar revolutionären Ziele zugunsten der Verteidigung der Sowjetunion zurückgestellt wurden, geschah dies nicht, weil eine machthungrige Bürokratie das Ziel der Weltrevolution aufgegeben hatte, sondern es wurde als vorübergehender taktischer Kompromiss verstanden, von dem aus man sich erhoffte, dass er später die Bedingungen für den Kampf gegen den Kapitalismus verbessern würde. Dabei kam es sicherlich zu vielen Fehleinschätzungen und dennoch war das Ergebnis dieser Politik auch, dass sich der Sozialismus zum Zeitpunkt von Stalins Tod nach Osteuropa, Korea, China und Indochina ausgebreitet hatte, während es den trotzkistischen Parteien in keinem Land der Welt gelungen war, eine sozialistische Revolution anzuführen.
Der trotzkistische Erklärungsansatz für die sowjetische Außenpolitik bezieht weder die Motivationen der kommunistischen Führer noch die objektiven Bedingungen, unter denen sie handelten, ernsthaft in die Analyse ein. Er ignoriert beide Seiten der Frage und konstruiert stattdessen eine Art Verschwörungstheorie, wonach eine neue bürokratische Schicht mit Stalin an ihrer Spitze entstanden sei, der es nur noch um Macht gegangen sei und für die der weltrevolutionäre Anspruch der kommunistischen Weltbewegung zum Problem wurde, weil es den revolutionären „Alleinvertretungsanspruch“ der Sowjetunion gefährdete und die Politik der Annäherung an die kapitalistischen Staaten behinderte. Zum Verständnis der tatsächlichen Geschichte hat diese Interpretation allerdings so gut wie nichts beizutragen.
4. Der Trotzkismus nach Trotzkis Tod
Da Trotzkis Lehre in all ihren Kernbestandteilen falsch ist, ist es nicht verwunderlich, dass seine Anhänger, indem sie der trotzkistischen Theorie folgten, auch in den Jahrzehnten nach dem Tod ihres großen Vorbilds weiterhin auf opportunistischen Abwegen wandelten. Die Spaltungstendenzen in der trotzkistischen Bewegung, die schon vor Trotzkis Tod begonnen hatten (mit der Bildung der spanischen POUM gegen Trotzkis Willen, den Auseinandersetzungen Trotzkis mit James Burnham und Max Shachtman über die Staatskapitalismus-These usw.), setzten sich nun mit erhöhter Intensität fort. Die wichtigste inhaltliche Spaltung war die zwischen den eher „orthodoxen“ Trotzkisten, die Trotzkis These des „degenerierten Arbeiterstaates“ folgten, und denjenigen Anhängern Trotzkis, die über ihren „Klassiker“ hinausgingen und die These aufstellten, die Sowjetunion sei nun gar kein Arbeiterstaat mehr, sondern „staatskapitalistisch“.
Die politischen Konsequenzen der Staatskapitalismusthese bestanden darin, dass die Teile der trotzkistischen Bewegung, die ihr folgten, endgültig ins Lager der Reaktion wechselten. So kritisierte Trotzkis Witwe Natalja Sedowa die IV. Internationale dafür, dass sie den völkermörderischen Koreakrieg der USA verurteilte: „Sogar jetzt unterstützt ihr die Armeen des Stalinismus in dem Krieg, der von dem gequälten koreanischen Volk erlitten wird“ (Sedova 1951). Noch weiter trieb es Tony Cliff, einer der Begründer der Staatskapitalismusthese, in seinem Buch „State Capitalism in Russia“. In einem Kapitel, das in der deutschen Übersetzung entfernt wurde, werden die faschistischen Kollaborateure, die sich während der deutschen Besatzung auf dem Gebiet der Sowjetunion formierten und an der Seite der Wehrmacht gegen die Rote Armee kämpften, als „antistalinistische Opposition“ positiv hervorgehoben. Sowohl die „Wlassow-Bewegung“, eine Gruppierung von übergelaufenen Soldaten der Roten Armee, die unter dem Kommando von Andrej Wlassow für Nazideutschland kämpften, als auch die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) des Faschistenführers Stepan Bandera, die ebenfalls mit der Wehrmacht verbündet war und sich an der Vernichtung der ukrainischen Juden und Polen beteiligte, werden von Cliff zehn Jahre nach Kriegsende wohlwollend erwähnt aufgrund ihrer angeblich „sozialistischen“ Programme (Cliff 1955, Kapitel 9).
Die „orthodoxen“ Trotzkisten, die an Trotzkis These des „degenerierten“ oder „deformierten“ Arbeiterstaates festhalten, vertraten solche extrem reaktionären Auffassungen in der Regel nicht. Doch auch sie haben immer wieder objektiv eine negative Rolle in der Arbeiterbewegung gespielt, allein schon indem sie die Kernpunkte von Trotzkis Lehre propagiert haben: Aufweichung des Demokratischen Zentralismus und den Entzug der Solidarität mit den angeblich „entarteten“ sozialistischen Ländern und den kommunistischen Parteien auf der ganzen Welt, die diese Länder unterstützten. Auch sie fanden sich in vielen konkreten Klassenkämpfen objektiv auf der Seite der Reaktion wieder.
Ein solches Beispiel bietet der Trotzkismus in Griechenland. Die Kommunistische Partei Griechenlands führte im Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Befreiungsfront EAM und ihrer Armee ELAS den Volkswiderstand gegen die faschistischen Besatzer an, sammelte dabei die große Mehrheit des Volkes hinter sich und brachte den Faschisten empfindliche militärische Niederlagen bei. Einige Trotzkisten bewiesen, dass sie ihre antifaschistischen Überzeugungen nicht aufgegeben hatten und unterstützten die EAM und ELAS. Die zwei größten trotzkistischen Gruppierungen DKEE und KDEE bekämpften dagegen offen den antifaschistischen Widerstand. Sie bezeichneten die Massenhinrichtungen Hunderter Kommunisten durch die Nazis im Mai 1944 als „Opfer der Politik der stalinistischen Partei in unserem Land, die durch den Partisanenkrieg, die Sabotage und die Ermordung deutscher Arbeiter und Bauern sowie die Praxis des individuellen Terrors den deutschen Generälen die notwendigen Vorwände liefert, um die Arbeiterbewegung zu enthaupten.“ (Papastavros 2006). Andere ähnliche Erklärungen betonten die Notwendigkeit, die Arbeitermassen von den „nationalistischen“ Organisationen (d.h. den antifaschistischen Widerstandsorganisationen) loszulösen, die „Morde“ an „deutschen Arbeitern“ (d.h. den militärischen Kampf gegen die Nazis) zu bekämpfen und setzten den „Terror“ des Widerstands mit dem der Besatzer gleich. In der Praxis waren sie über eine Gleichsetzung von Faschismus und „Stalinismus“ jedoch schon längst hinaus, denn das hätte zumindest bedeutet, den Faschismus mit derselben Intensität zu bekämpfen wie die Kommunisten. In Wirklichkeit agierten diese Trotzkisten längst objektiv als Agenten der Nazis: Den Terror der faschistischen „Sicherheitsbataillone“, die Tausende Antifaschisten ermordeten, erwähnten diese Gruppen mit keinem Wort, aber die Verteidigungsmaßnahmen der Volksbewegung, die die überwältigende Mehrheit der Arbeiter und Bauern hinter sich wusste, wurden dafür umso schärfer attackiert. Auch wenn sie nicht offen für die Nazis arbeiteten, war dennoch klar, dass ihre Haltung gegen den antifaschistischen Widerstand nur den Besatzern nutzte. Den sprichwörtlichen Vogel schoss die trotzkistische „Archiomarxistische Partei Griechenlands“ ab, die auch 1949 noch legal ihren Geschäften nachgehen konnte, während gegen Mitglieder und Sympathisanten der KKE der nackte Terror in Form von Massenerschießungen und Konzentrationslagern wütete: Sie gratulierte öffentlich dem faschistischen Regime zu seinem Sieg über die kommunistische Partisanenbewegung (ebenda). Im heutigen Griechenland spielt der Trotzkismus nach diesen Episoden nur eine randständige Rolle, während die Kommunistische Partei Einfluss auf breite Massen der Arbeiterklasse nimmt.
George Orwell, der stark vom Trotzkismus beeinflusst war und im Spanischen Bürgerkrieg in einer Einheit der quasi-trotzkistischen POUM gekämpft hatte, entwickelte sich zu einem der prominentesten Vertreter des Propagandafeldzuges gegen den Kommunismus und die Sowjetunion und seine antikommunistischen Romane („Animal Farm“, „Mein Katalonien“, „1984“) gelten bis heute als literarische „Klassiker“. Ähnlich wie Trotzki war Orwell überzeugt, dass „die Zerstörung des sowjetischen Mythos essentiell (sei), wenn wir die sozialistische Bewegung wiederbeleben (!) wollen“. Kurz vor seinem Tod wurde Orwell zum Informanten des britischen Geheimdiensts IRD und denunzierte Dutzende Kommunisten, Sympathisanten oder Personen, die ihm nicht antikommunistisch genug waren. Juden erschienen ihm wohl besonders verabscheuungswürdig, weshalb er bei einigen Personen hinter dem Namen den Zusatz „Jude“ ergänzte. Im Gegenzug half das IRD bei der Verbreitung und Übersetzung von Orwells reaktionärem Propagandawerk „Animal Farm“ (Ash 2003).
Orwell ist nur das berühmteste Beispiel eines ehemaligen Trotzkisten, der sich nach Trotzkis Tod in einen stramm rechten Kalten Krieger und Apologeten der Verbrechen des US-Imperialismus verwandelte. Ein anderes Beispiel wurde bereits genannt – Trotzkis Witwe Natalja Sedowa. Auch die bereits erwähnten Trotzkisten Max Shachtman und James Burnham wurden zu offenen Reaktionären und wurden wichtige Vertreter der antikommunistischen Strömung des Neokonservatismus. Besonders die von Max Shachtman beeinflusste Strömung in den USA ging offen ins Lager des Imperialismus und der Reaktion über und unterstützte die USA im Koreakrieg, in ihrer Invasion auf Kuba 1961 sowie im Vietnamkrieg. Burnham arbeitete im Zweiten Weltkrieg für den OSS, den Vorläufer der CIA. Nach dem Krieg trat er wie Shachtman für eine extreme aggressive US-Außenpolitik gegenüber der Sowjetunion ein. Auch andere wichtige Figuren des US-amerikanischen Neokonservatismus wie Irving Kristol und Seymour Martin Lipset hatten eine Vergangenheit in trotzkistischen Organisationen (King 2004, S. 254ff).
Es ließen sich zahlreiche spätere Beispiele aufzählen, bei denen Trotzkisten ebenfalls eine ausgesprochen negative Rolle spielten. So unterstützen zahlreiche trotzkistische Organisationen bis heute den konterrevolutionären Aufstand in Ungarn 1956, bei dem ein fanatischer rechter Mob viele Kommunisten auf offener Straße massakrierte (z.B. Ullrich 2016). Ein Erfolg des Aufstands hätte unweigerlich dazu geführt, dass Ungarn aus dem Warschauer Vertrag austreten und unter den Einfluss der NATO geraten würde, sodass der Kapitalismus wiederhergestellt worden wäre. Eine ähnliche Haltung nehmen verschiedene trotzkistische Gruppen zum sogenannten „Prager Frühling“ ein: 1968 war in der Tschechoslowakei eine antisozialistische Strömung an die Macht gelangt, die – sehr ähnlich wie die Gruppe um Gorbatschow 20 Jahre später in der Sowjetunion – mit Phrasen über „Demokratie“ und „Freiheit“ begann, im rasanten Tempo den Sozialismus zu demontieren (Kommunistische Organisation 2018). Auch dieser Angriff gegen den Sozialismus wird von unterschiedlichen trotzkistischen Gruppen bis heute verteidigt (z.B. SAV 2008; Marx21 2018).
5. Schlussfolgerung
Wenn der Trotzkismus historisch immer wieder eine negative Rolle gegen die Interessen der Arbeiterklasse gespielt hat, woher kommt dann seine anhaltende Attraktivität?
Ein Teil der Antwort ist, dass der Trotzkismus von der antikommunistischen Propaganda der Bourgeoisie profitiert. Er übernimmt, vor allem in seinen weiter rechts stehenden Varianten, in wesentlichen Punkten die Geschichtsschreibung des antikommunistischen Mainstreams und ignoriert oft sogar die Forschungsergebnisse von ehrlicheren bürgerlichen Historikern, die tatsächlich mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten, wie Arch Getty, Robert Thurston, Lars Lih usw. Der Trotzkismus findet teilweise auch deshalb Verbreitung, weil besonders Intellektuelle und Akademiker mit kleinbürgerlichem Klassenhintergrund systematisch ein antikommunistisches Geschichtsbild eingeimpft bekommen. Zudem gibt es bei diesen Intellektuellen oft die Tendenz, sich vor den Härten des Klassenkampfes zu scheuen. Dabei bietet Trotzki eine vermeintlich „humanere“ Alternative. Das macht es leichter, sich als Marxist, als Revolutionär zu verstehen, denn man kann sich immer auf den „wahren“, den „demokratischen“ und „humanistischen“ Kern des Marxismus berufen und sich von den Teilen revolutionärer Geschichte abgrenzen, die am meisten vom Klassenfeind unter Beschuss genommen werden. Das ist Ausdruck einer opportunistischen Haltung, weil der Trotzkismus die schwierige, aber unverzichtbare Aufgabe, die Geschichte der Arbeiterbewegung in ihrer Gänze kritisch zu verteidigen, eben aufgibt zugunsten eines Geschichtsbildes, das zwar leichter Anklang findet, aber in fundamentalem Widerspruch zu den Fakten steht und letztlich auch völlig dabei versagt, die Fehler unserer Geschichte glaubwürdig aufzuarbeiten. Sicherlich trifft all dies auch nicht auf jeden individuellen Trotzkisten zu, die Motive und Überzeugungen können im Einzelfall natürlich auch andere Ursachen haben.
Der Trotzkist Ernest Mandel hat ein bekanntes Buch mit dem Titel „Trotzki als Alternative“ geschrieben (Mandel 1992). Doch eine Alternative war Trotzki nie. Weder ergab sich aus seiner Kritik der „Bürokratie“ ein ernstzunehmendes Programm für den sozialistischen Aufbau in der Sowjetunion, noch ließ sich aus seiner Polemik gegen den Sozialismus in einem Land eine bessere Strategie für die Weltrevolution ableiten. Trotzki selbst entwickelte sich auf der Grundlage dieser falschen Theorien von einem schädlichen ideologischen Einfluss innerhalb der Arbeiterbewegung zu einem Verräter, der kaum noch etwas anderes tat, als gegen die Sowjetunion und die kommunistische Weltbewegung zu arbeiten. Ehrliche Sozialisten und Revolutionäre, die für den Sturz des Imperialismus und einen neuen Anlauf zum Sozialismus kämpfen wollen, wären gut damit beraten, den Trotzkismus als das was er ist zu den Akten zu legen – ein fataler Irrweg.
Literatur:
Acton, Edward/ Stableford, Tom 2007: The Soviet Union. A Documentary History. University of Exeter Press: Exeter.
Ash, Timothy Garton 2003: Orwell’s List, The New York Review of Books, 25.9.2003.
Bolton, Kerry R. 2011: The Moscow Trials in Historical Context, Foreign Policy Journal 22.4.2011, online: http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/04/22/the-moscow-trials-in-historical-context/view-all/
Chase, William J. 1995: Trotzki in Mexiko: Eine Geschichte seiner informellen Kontakte mit der US-Regierung 1937-1940 (russisch: Trockij v Meksike : k istorii ego neglasnych kontaktov s pravitel’stvom SŠA 1937-1940), in:Otečestvennaja istorija (Moskva), 1995 (4), S. 76-102.
CIA 1994: Leon Trotsky, Dupe of the NKVD, online: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol16no1/html/v16i1a03p_0001.htm
Cliff, Tony 1955: State Capitalism in Russia, Kapitel 9, online: https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1955/statecap/ch09.htm
Dimitrov, Georgi 2003: The Diary of Georgi Dimitrov, 1933-1949, Yale University.
Dimitroff, Georgi 1935: Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommunistischen Internationale. im Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus, online: http://www.mlwerke.de/gd/gd_001.htm
Doernberg, Stefan 1964: Kurze Geschichte der DDR, Dietz Verlag GmbH Berlin, 1. Auflage.
Firsov, Fridrikh I./ Klehr, Harvey/ Haynes, John Earl 2014: Secret Cables of the Comintern 1933-1943, Yale University Press.
Furr, Grover 2015: Trotsky’s Amalgams. Trotsky’s Lies, the Moscow Trials as evidence, the Dewey Commission. Trotsky’s Conspiracies in the 1930s, Volume One.
Getty, J. Arch/ Naumov, Oleg V. 1999: The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks 1932-1939, Yale University Press: New Haven and London.
Getty, J. Arch 1986: Trotsky in Exile. The Founding of the Fourth International, Soviet Studies 38 (1), 24-35
Getty, J. Arch 1991: State and Society under Stalin: Constitutions and Elections in the 1930s, Slavic Review 50 (1), 18-35
Getty, J. Arch 2002: “Excesses are not permitted”: Mass Terror and Stalinist Governance in the Late 1930s, Russian Review 61 (1), 113-138
Gramsci, Antonio: Gefängnishefte, Argument Verlag Hamburg.
King, William F. 2004: Neoconservatives and ‘Trotkyism’, American Communist History, Vol 3., No. 2.
Klasse gegen Klasse 2013: Was ist Entrismus?, online: https://www.klassegegenklasse.org/was-ist-entrismus/#footnote-3931-1
Kommunistische Organisation 2018: Der ‚Prager Frühling‘ in der Tschechoslowakei 1968: Die verhinderte Konterrevolution, https://develop.kommunistische-organisation.de/hintergrund/der-prager-fruehling-in-der-tschechoslowakei-1968-die-verhinderte-konterrevolution/
Kubi, Michael 2019: Zur Geschichte der Sowjetunion. Eine totalitäre Diktatur der Bürokraten?, Zeitschrift offen-siv, Bodenfelde.
Lenin, Wladimir I. 1904: Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück , LW 7, S. 197-430
Lenin, Wladimir I. 1910a: Der historische Sinn des innerparteilichen Kampfes in Russland, LW 16, S. 381-399
Lenin, Wladimir I. 1910b: Brief an das Russische Kollegium des ZK der SDAPR, LW 17, S. 1-6.
Lenin, Wladimir I. 1911: Über die Diplomatie Trotzkis und über eine Plattform von parteitreuen Sozialdemokraten, LW 17, S. 349-353.
Lenin, Wladimir I. 1914: Der Zerfall des „August“blocks, LW 20, S. 151-154.
Lenin, Wladimir I. 1915: Über die Losung der vereinigten Staaten von Europa, LW 21, S. 342-346.
Lenin, Wladimir I. 1916: Das Militärprogramm der proletarischen Revolution, LW 23, S. 72-83.
Lenin, Wladimir I. 1917: An A.M. Kollontai, 17. Februar, LW 35, S. 262-264.
Lenin, Wladimir I. 1918: Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky, LW 28, S. 225-327.
Lenin 1920: Über die Gewerkschaften, die gegenwärtige Lage und die Fehler Trotzkis, LW 32, S. 1-26.
Lenin, Wladimir I. 1921a: Die Krise der Partei, LW 32, S. 27-38.
Lenin, Wladimir I. 1921b: II. Gesamtrussischer Verbandstag der Bergarbeiter, LW 32, S. 39-55.
Lenin, Wladimir I. 1921c: Noch einmal über die Gewerkschaften, die gegenwärtige Lage und die Fehler Trotzkis und Bucharins, LW 32, S. 58-100.
Lenin, Wladimir I. 1921d: X. Parteitag der KPR (B), LW 32, S. 163-277.
Lenin, Wladimir I. 1922: Brief an den Parteitag, LW 36, S. 577-582.
Lenin, Wladimir I. 1923: Über das Genossenschaftswesen, LW 33, S. 453-461.
Lih, Lars T./ Naumov, Oleg V./ Khlevniuk, Oleg V. 1995: Stalin’s letters to Molotov, 1925-1936, Yale University Press, New Haven and London.
Domenico Losurdo 2012: Geschichte und Kritik einer schwarzen Legende, PapyRossa Köln
Mandel, Ernest 1992: Trotzki als Alternative, Dietz Verlag Berlin.
Martens, Ludo 1998: Stalin anders betrachtet, EPO vzw Verlag, Berchem.
Marx21 2018: Aufbruch 1968. Der Prager Frühling, online: https://www.marx21.de/aufbruch-1968-der-prager-fruehling/
Orgambides, Fernando 1993: La historia de un confidente de lujo, El País, 22.11.1993, online: https://elpais.com/diario/1993/11/22/ultima/753922801_850215.html .
Papastavros, Kyrillos 2006: Die opportunistische Strömung des Trotzkismus (griechisch i.O.: Το οπορτουνιστικό ρεύματου τροτσκισμού), KOMEP, Heft 6.
Präsidium des EKKI 1943: Beschluss über die Auflösung der Komintern, online: https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0026_auf_de.pdf
Reed, John 1957: Zehn Tage, die die Welt erschütterten, 21. Aufl., Dietz Verlag Berlin.
Sarovic, Alexander 2017: Der Prophet und der Eispickel, Der Spiegel 17.8.2017.
SAV 2008: 40 Jahre ‘Prager Frühling’, 11.4.2008, online: https://www.sozialismus.info/2008/04/12602/
Sayers, Michael/ Kahn, Albert E. 1946: The Great Conspiracy against Russia, Collett’s Holdings.
Sedova Trotsky, Natalia 1951: Resignation from the Fourth International, The Militant 15 (23), 4. Juni 1951, online: https://www.marxists.org/archive/sedova-natalia/1951/05/09.htm
Skolarikos, Kostas 2016: Die Strategie der KKE und der Kampf der DSE (griechisch: Η στρατηγική του ΚΚΕ και οαγώνας του ΔΣΕ), in: Geschichtsabteilung des ZK der KKE: Demokratische Armee Griechenlands (griech.: Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας), Verlag Syngchroni Epochi (Σύγχρονη Εποχή), Athen, S. 106-129.
Spanidis, Thanasis 2017: Der VII. Weltkongress der Komintern und seine Folgen. Für eine kritische Neubewertung der antifaschistischen Politik der Komintern, online unter: https://develop.kommunistische-organisation.de/diskussion/der-vii-weltkongress-der-komintern-und-seine-folgen/
Spanidis, Thanasis 2018: War die Sowjetunion ‚staatskapitalistisch‘ und ‚sozialimperialistisch‘?, online: https://develop.kommunistische-organisation.de/wp-content/uploads/2018/07/Spanidis-War-die-SU-sozialimperialistisch.pdf
Stalin, Josef W. 1924a: Über die Grundlagen des Leninismus. Vorlesungen an der Swerdlow-Universität, SW 6, S. 62-166.
Stalin, Josef W. 1924b: Trotzkismus oder Leninismus? Rede auf dem Plenum der kommunistischcen Fraktion des Zentralrats der Gewerkschaften der Sowjetunion, SW 6, S. 290-319
Stalin, Josef W. 1926: Zu den Fragen des Leninismus, SW 8, S. 12-81
Stalin, Josef W. 1927a: Die trotzkistische Opposition früher und jetzt. Rede in der Sitzung des vereinigten Plenums des ZK und der ZKK der KPdSU(B), 23.10.1927; gedruckt in der Prawda Nr. 251 am 2.11.1927, SW 10, S. 150-179.
Stalin, Josef W. 1927b: Politischer Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees zum XV. Parteitag der KPdSU(B), SW 10, S. 235-307.
Stalin, Josef W. 1928a: Rede auf dem VIII. Kongress des Leninschen Kommunistischen Jugendverbands der Sowjetunion, SW 11, S. 59-69.
Stalin, Josef W. 1928b: Gegen die Vulgarisierung der Losung der Selbstkritik, SW 11, S. 113-122.
Stalin, Josef W. 1952: Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Dietz Verlag Berlin.
Trotsky, Leon 1930: My Life, online: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/mylife/index.htm
Trotsky, Leon 1936: The Lesson of Spain, Socialist Appeal, Vol. 2 No. 8, online https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/07/spain.htm
Trotzki, Leo 1904: Über unsere politischen Aufgaben, online: https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/1904/leo-trotzki-unsere-politischen-aufgaben
Trotzki, Leo 1906: Ergebnisse und Perspektiven, online: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1906/erg-pers/index.htm
Trotzki, Leo 1921: Rolle und Aufgaben der Gewerkschaften, online: https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/1921/leo-trotzki-rolle-und-aufgaben-der-gewerkschaften
Trotzki, Leo 1921: Rolle und Aufgaben der Gewerkschaften, Russische Korrespondenz, II. Jahrgang, Heft 3/4, März/April 1921, S. 158-170, online: https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/1921/leo-trotzki-rolle-und-aufgaben-der-gewerkschaften
Trotzki, Leo 1929: Die permanente Revolution, online: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1929/permrev/index.htm
Trotzki, Leo 1936: Verratene Revolution. Was ist die Sowjetunion und wohin treibt sie?, online: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1936/verrev/index.htm
Trotzki, Leo 1938a: Ihre Moral und unsere, online: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1938/moral/moral.htm
Trotzki, Leo 1938b: Brief über Defätismus, online: https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/1938/leo-trotzki-brief-ueber-defaetismus
Trotzki, Leo 1939a: Stalin – Hitlers Quartiermeister, online: https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/trotzki-sowjetunion/leo-trotzki-stalin-hitlers-quartiermeister
Trotzki, Leo 1939b: Das Zwillingsgestirn Hitler-Stalin, Liberty 27.1.1940, online: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1939/12/zwilling.htm
Trotzki, Leo 1939c: Verteidigung des Marxismus. Eine kleinbürgerliche Opposition in der Socialist Workers‘ Party, online: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1939/12/vdm-kboswp.html
Trotzki, Leo 1939d: Die UdSSR im Krieg. Online: https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/1939/leo-trotzki-die-udssr-im-kriege
Trotzki, Leo 1940: Stalin, Nachtrag: I. Die thermidorianische Reaktion) https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/trotzki/1940/leo-trotzki-stalin-eine-biographie/i-die-thermidorianische-reaktion
Ullrich, Doreen 2016: Vor 60 Jahren: Die ungarische Revolution, 22.10.2016, online: https://www.sozialismus.info/2016/10/vor-70-jahren-die-ungarische-revolution/
Walker, Denver 1985: Quite Right, Mr. Trotsky, London, Speediprinters.
Workers’ Liberty 2010: An anti-Stalinist Gramsci, online: https://www.workersliberty.org/index.php/story/2017-07-26/anti-stalinist-gramsci